
Bücher zum jüdischen Berlin
|
 |
Stadt, nicht Land, Israelis, nicht Juden,
Hebräisch, nicht Jiddisch:
Israelis in Berlin
Ihre Stadterkundungen scheinen Fania
Oz-Salzberger auf Abwege geführt zu haben. Denn das Resultat ihres
Berlinaufenthalts als Stipendiatin des Wissenschaftskollegs ist
keine akademische Untersuchung, sondern ein Reisebuch. In ihm geht
es um die Frage: "Wie lebt es sich als Israeli in Berlin." In einer
Stadt, "die ihre jüdischen Einwohner anlockte, veränderte und
schließlich tötete"... |
 |
Eine Buchrezension von Evelyn Adunka:
Die
weltweit erste Rabbinerin
- Regina Jonas
Das Leben und Schicksal der weltweit
ersten Rabbinerin, der Berlinerin Regina Jonas, blieb bis heute ein
Mythos und war lange Zeit vergessen... |
 |
Zum Beispiel Ruth Liebrecht:
Pionierinnen jüdischen Lernens
Die Hochschule für die Wissenschaft des
Judentums in Berlin war ohne Zweifel eines der wichtigsten geistigen
Zentren des deutschen Judentums. Gegründet 1872 hat hier bis zu ihrer
Zwangsschließung 1942 über sieben Jahrzehnte lang die intellektuelle
Elite der jüdischen Gemeinschaft gewirkt, darunter Rabbiner Leo Baeck... |
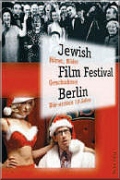 |
Jewish FilmFestival Berlin:
Wie passen rund 180 Filme in ein Buch?
Wer mit Juden und über Juden lachen will,
der ist auf dem Jewish-Film-Festival Berlin – JFFB – bei der richtigen
Adresse. Und - so kann man sich fragen, ist es ein jüdisches
Filmfestival oder ein Festival jüdischer Filme oder ein Filmfestival des
jüdischen Berlins?... |
 |
Berlin (DDR):
Ein politischer Spaziergang
Genau wie von der Mauer ist von den politischen
Machtzentren der DDR im Berliner Straßenbild kaum noch etwas zu
entdecken. Die meisten Gebäude sind inzwischen umgestaltet und werden
anders genutzt, manch neuer Eigentümer möchte auch nicht an die früheren
Hausherren erinnert werden... |
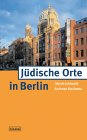 |
Neuer Stadtführer:
Jüdische Orte in Berlin
Jüdisches Leben in Berlin konnte man im Berlin der zwanziger
Jahre überall finden: große Synagogen, kleine Betstuben, Wohnorte
prominenter jüdischer Berliner, Fabriken, Theater, Galerien, Ateliers,
Quartiere derer, die im Dunkeln standen ... Nicht nur in den Zentren, auch
in den Randbezirken und Vororten gab es Stätten, die vom Wirken jüdischer
Berliner zeugten...
|
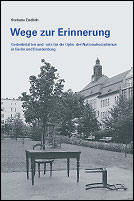 |
Berlin-Brandenburg:
Topografie des Terrors
In die Jacke oder den Mantel passt es nicht, das neue
Buch von Stefanie Endlich. Man braucht schon eine größere Tasche wenn
man es auf eine Tour durch Berlin oder Brandenburg mitnehmen will. Das
aber sollte man tun. Es gibt bislang keinen besseren Begleiter, der bei
der Suche nach Gedenkstätten und –orten für die Opfer des
Nationalsozialismus in Berlin und Brandenburg behilflich ist... |
 |
Demokratische Kultur des Respekts:
Anetta Kahane über verdrängten
Nationalsozialismus und Rassismus in der DDR
Nicht umsonst streiten noch Jahre nach dem Untergang der
DDR Forscherinnen und Forscher über den Charakter ihres
Herrschaftssystems. Ist die DDR vor allem als "moderne Diktatur", oder
gar "totalitäre Diktatur" zu kennzeichnen?
|
 |
Das Berliner Telefonbuch von 1941:
Namen, Nummern, Naziterror
Auf einem Flohmarkt entdeckte der Politikprofessor Hartmut Jäckel eine
Ausgabe des Berliner Telefonbuchs von 1941. Friedlich nebeneinander
aufgereiht fanden sich da Täter und Opfer der NS-Zeit, Nazigrößen neben
Künstlern, Mitläufer, Seite an Seite mit Widerständlern... |
|
|
Biografie einer Großfamilie:
Die Liebermanns
Als das Transparent mit dem Stammbaum der Familie Liebermann
vollständig entrollt war, waren für einige Augenblicke Autorin und Bühne
unsichtbar. 1996 hat das Centrum Judaicum die Gedächtnisausstellung für Max
Liebermann aus dem Jahr 1936 im damaligen jüdischen Museum in der
Oranienburger Straße sowie den Werdegang der Bilder so weitgehend wie
möglich unter dem Titel "was vom Leben übrig bleibt sind Bilder und
Geschichten" rekonstruiert... |
 |
Ein jüdisches Schicksal:
Versprich mir, dass du am
Leben bleibst
Sephardische Juden waren in Berlin
immer eine kleine Minderheit. Abgesehen von Biografien einzelner bekannter
Persönlichkeiten unter ihnen (Henriette Herz, Heinrich Heine, Rosa
Luxemburg) wissen wir wenig über das Alltagsleben der kleinen Leute unter
ihnen...
|
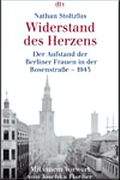 |
Der Aufstand in der Rosenstraße:
"Widerstand des Herzens"
Anfang März 1943 wurden in Berlin die noch in der
Stadt verbliebenen Juden, vor allem aus sogenannten Mischehen, von der
Gestapo verhaftet und in ein Sammellager in der Rosenstraße gebracht, um
deportiert zu werden... |
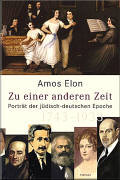 |
Amos Elon:
Zu einer anderen Zeit
Die faszinierende Geschichte der Blütezeit der
jüdisch-deutschen Epoche: Der israelische Schriftsteller und Journalist
Amos Elon beleuchtet diese spannende und bewegende Periode der
Kulturgeschichte, die 1743 mit der Übersiedlung Moses Mendelssohns nach
Berlin beginnt und von Hannah Arendts Flucht im Jahr 1933 abgeschlossen
wird... |
|
|
Nachricht von
Chotzen:
Eine
jüdisch-christliche Familie in Berlin
Die Gedenkstätte Haus der
Wannsee-Konferenz zeigt bis Ende März 2002 in einer kleinen
Sonderausstellung das Schicksal einer jüdische-christlichen Familie. Im
Archiv der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz befindet sich der wohl
umfangreichste Bestand an Post- und Rückantwortkarten aus dem Ghetto
Theresienstadt, die alle an einen Adressaten gerichtet sind. Auf jeder Karte
aus den Jahren 1943 und 1944 steht die selbe Adresse: "An Frau Elsa
Chotzen, Johannisberger Str. 3, Berlin-Wilmersdorf, paterre rechts"... |
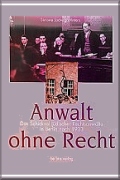 |
Anwalt ohne Recht:
Das
Schicksal jüdischer Rechtsanwälte in Berlin nach 1933
In Berlin gab es 1933 3.890
Rechtsanwälte. Mehr als 1.800, also rund die Hälfte, galten nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten als Nichtarier". Am 31. März 1933
wurden Berliner Gerichtsgebäude von SA-Trupps gestürmt, nachdem lautstark
gefordert worden war, alle als jüdisch bekannten Richter, Staatsanwälte,
Rechtsanwälte und Beamte zu entfernen".... |
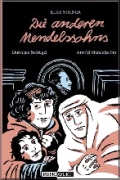 |
Neuer Comic von Elke Steiner:
Die anderen Mendelssohns
Die Familie ist heute vor allem wegen zwei
ihrer Vertreter berühmt. Zum einen Moses Mendelssohn, Begründer der
Haskalah, der jüdischen Aufklärung. Zum anderen dessen Enkel, der Komponist
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Von den übrigen Familienmitgliedern ist so gut
wie nichts bekannt. Ihr Schicksal zeigt die wechselvolle Geschichte, die
wie "ein Mikrokosmos der "deutsch-jüdischen Symbiose" 150 Jahre Berliner
Geschichte" widerspiegelt... |
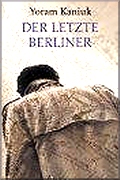 |
Yoram Kaniuk:
Der letzte Berliner
Er ist der größte Partylöwe
Berlins. Er trägt am liebsten weiße Anzüge, hat blond gefärbtes Haar. Er
schläft jeden Tag mit einer seiner Tänzerinnen, ihm gehören Berlins
bekannteste Nachtclubs. Den Mann gibt es tatsächlich, er heißt Rolf Eden,
sein (Nacht-)Leben: Stoff genug für eine bissige Realsatire über Berlin und
dessen krampfhaft-glamouröse Halbwelt... |