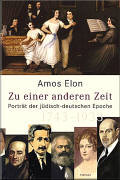
[Bestellen?]
Rezension:
Porträt der jüdisch-deutschen Epoche
1794 -1933 |
Amos Elon:
Zu einer anderen Zeit
Porträt der jüdisch-deutschen Epoche (1743-1933)
Aus dem Amerikanischen von Matthias Fienbork
März 2003, 424 Seiten, 49 s/w-Abbildungen
EUR 24,90 / SFR 42,80,
ISBN 3-446-20283-8
Die faszinierende Geschichte der Blütezeit der
jüdisch-deutschen Epoche: Der israelische Schriftsteller und Journalist
Amos Elon beleuchtet diese spannende und bewegende Periode der
Kulturgeschichte, die 1743 mit der Übersiedlung Moses Mendelssohns nach
Berlin beginnt und von Hannah Arendts Flucht im Jahr 1933 abgeschlossen
wird.
Anhand atmosphärischer Reportagen, von Kurzporträts und
Dialogen weckt Elon diese andere Zeit mit ihren Tragödien und Erfolgen,
mit ihren großen Namen - wie Heinrich Heine, Rahel Varnhagen, Karl Marx
und vielen anderen - wieder zum Leben.
Aus der Einleitung:
Im Herbst 1743 stand ein vierzehnjähriger Junge vor dem
Rosenthaler Tor, dem einzigen in der Berliner Stadtmauer, das für Juden
(und Vieh) zugelassen war. Fünf, sechs Tage war er, aus Dessau kommend,
der Hauptstadt des kleinen Herzogtums Dessau-Anhalt, durch die Mark
Brandenburg gewandert. Wir wissen nicht, ob er Schuhe trug;
wahrscheinlicher ist, daß er barfuß unterwegs war.
Der Knabe, der später in ganz Europa als der berühmte Philosoph Moses
Mendelssohn Anerkennung finden sollte, war klein und schmächtig für sein
Alter. Er hatte dünne Arme und Beine, einen Buckel und stotterte. Der
mißgebildete Rücken könnte genetisch bedingt (nach modernen
medizinischen Erkenntnissen sind von dem ausgeprägtesten Typus, zu dem
häufig noch das Stottern kommt, besonders Juden mitteleuropäischer
Herkunft betroffen) oder die Auswirkung einer Rachitis gewesen sein,
einer damals verbreiteten Kinderkrankheit. Das Äußere des Knaben »hätte
das roheste Herz bewegen können«, wie ein Zeitgenosse schrieb, er hatte
jedoch ein auffällig hübsches Gesicht.1 Funkelnde Augen unterstrichen
die hohe Stirn, Nase, Wangen, Lippen und Kinn waren fein und
wohlgeformt.
Der alleinreisende, mittellose Junge trug seine wenigen Habseligkeiten in
einem Beutel auf dem Rücken. Für reisende Juden galten zu jener Zeit
strenge Bestimmungen. Nur eine begrenzte Anzahl von reichen Juden (und
gelegentlich auch ein Gelehrter) durfte sich in Berlin niederlassen,
fahrenden Händlern indes wurde der Zutritt verwehrt. Juden, die die
Stadt betreten wollten, und sei es nur für ein paar Tage, wurden über
Herkunft und Zweck ihrer Reise ausgefragt. Sofern ihnen eine befristete
Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, mußten sie Zoll entrichten, als
wären sie eine Handelsware, und zwar denselben Zollsatz, der auf
polnische Ochsen erhoben wurde. Dem Torsteher oblag es, »die ankommenden
Juden anzuzeigen, auf dieselben Achtung zu geben und die fremden
wegzuschaffen«.2
Im Preußen des aufgeklärten Friedrich II. ging es vergleichsweise
toleranter zu als in den meisten anderen deutschen Staaten; offiziell
galten die meisten Juden (und alle Leibeigenen) als minderwertige
Menschen. Im Wachjournal des Torstehers von 1743 findet sich der
Eintrag: »Heute passierten das Tor 6 Ochsen, 7 Schweine, 1 Jude.«3 Von
Mendelssohns Befragung am Rosenthaler Tor sind mehrere Versionen
überliefert. So soll der Wächter den Jungen, den er für einen
Trödelhändler hielt, gefragt haben: »Jude, was hast du zu verkaufen?
Vielleicht gefällt es mir.« Mendelssohn erwiderte: »Womit ich handle,
das kaufen Sie ja doch nicht.« »Heraus damit! Womit handelst du?« »Mit
V-V-Vernunft.« Einer anderen Quelle zufolge soll er auf die Frage, was
er in Berlin zu tun beabsichtige, geantwortet haben: »Lernen.«
[ ... ]
Mendelssohn war der erste praktizierende Jude, der völlig in der deutschen
Kultur aufging, und auch der erste deutsche Jude, der in ganz Europa als
Philosoph und Gelehrter geschätzt und bewundert wurde. Er war ein enger
Freund Lessings und anderer herausragender Vertreter der deutschen
Aufklärung. Seine Zeitgenossen priesen ihn überschwenglich. Christian
Martin Wieland grüßte ihn »mit dem heiligen Namen der Freundschaft«. Man
nannte ihn einen »deutschen Sokrates« und einen »jüdischen Luther«. Weil
er für einen aufgeklärten säkularen Staat eintrat, verglich Mirabeau ihn
mit den Vätern der amerikanischen Verfassung.
Das ganze neunzehnte Jahrhundert hindurch priesen und idealisierten
deutsche Juden voller Stolz die berühmten Freundschaften Mendelssohns zu
Nichtjuden und schöpften Hoffnung daraus. Ihr Stolz war ein Indiz ihrer
eigenen Schwierigkeiten, ähnlich wie er akzeptiert zu werden, und
vielleicht auch ein Trost. Mendelssohn wurde ihr Schutzheiliger, ein
Vorbild für all jene, die ihre ethnische oder religiöse Identität
bewahren, am Kulturleben der Mehrheit aber teilhaben wollten. Er war der
erste in einer langen Reihe von assimilierten deutschen Juden, die die
deutsche Kultur verehrten und deren Bestrebungen zwei Jahrhunderte
später ein so grauenhaftes und abruptes Ende finden sollten. Einige
waren talentierter als andere, manche besaßen überhaupt kein Talent,
aber die meisten fühlten sich dem Land ihrer Geburt auf das engste
verbunden.
Ihre Geschichte, von den Tagen Mendelssohns bis zum Aufstieg des
Nationalsozialismus – diese vielversprechende, aber auch bedrückende,
komplizierte und am Ende so schreckliche Geschichte ist Thema des
vorliegenden Buches. Es folgt der Sartreschen Definition, wonach
derjenige Jude ist, der von anderen als Jude angesehen wird – unabhängig
von seiner religiösen oder ethnischen Orientierung. Es ist eine
historische, keine soziologische Studie. Anders als der Soziologe kann
der Historiker mit dem Einzelfall leben. Das Buch verfolgt das Schicksal
und die Ideen einiger interessanter, meist säkularer und oft
faszinierender Personen, die vielleicht nicht repräsentativ, sondern
eher Symbole waren. Niemand sah das Ende voraus. Die Dualität von
Deutschen und Juden – zwei Seelen in einem Körper – beschäftigte und
quälte die deutschen Juden im ganzen neunzehnten Jahrhundert und in den
ersten Dekaden des zwanzigsten. Nirgendwo sonst in Westeuropa war diese
Dualität so ausgeprägt und am Ende so tragisch.
Für die frühe Zeit liegen keine zuverlässigen Bevölkerungsstatistiken vor.
Im achtzehnten Jahrhundert dürften in den deutschen Staaten kaum mehr
als sechzigtausend Juden gelebt haben, weniger als ein halbes Prozent
der gesamten deutschen Bevölkerung. Zu dieser kleinen, verstreuten
Gruppe kamen dann die Juden in Schlesien, Posen und anderen, überwiegend
slawischen Ostgebieten, die Preußen in drei Kriegen erobert hatte. 1871
waren die Juden noch immer eine verschwindend kleine Minderheit, deren
Anteil an der Gesamtbevölkerung bei knapp über einem Prozent lag.
Sechzig Jahre später, kurz vor Hitlers Machtergreifung, war der Anteil
der Juden an der Gesamtbevölkerung auf 0,8 Prozent gesunken. Man fragt
sich, wie eine so kleine Bevölkerungsgruppe, auch nur indirekt, eine
derart massive Feindseligkeit auslösen konnte. Verglichen mit anderen
ethnischen Gruppen waren die Juden eine winzige Minderheit. Selten
jedoch hat es eine Minderheit gegeben, die im wirtschaftlichen und
kulturellen Leben so sichtbar war und – im Guten wie im Schlechten – in
der öffentlichen Wahrnehmung so übertrieben groß erschien und
überschätzt wurde. In relativ kurzer Zeit brachte diese kleine
Gemeinschaft eine enorme Zahl von Unternehmern, Künstlern,
Schriftstellern, Publizisten, Gelehrten und demokratischen Politikern
hervor. Der unübersehbare Erfolg von Juden löste heftigen Neid,
Ressentiments und eine krankhafte, fast pornographische Neugier aus. Im
Zerrspiegel der allgemeinen Vorstellung wurden Juden übertrieben mächtig
wahrgenommen, als eine Gefahr für die Nation und ihre Identität, für
Kultur, »Volkshygiene« und das Allgemeinwohl.
Die kurzzeitige Emanzipation der Juden während der Napoleonischen Kriege
setzte beispiellose wirtschaftliche, berufliche und kulturelle Energien
frei. Es schien, als wäre plötzlich ein Damm gebrochen. In der jüdischen
Geschichte war, wenn auch in geringerem Umfang, schon einmal ähnliches
passiert – im islamischen Spanien. Kurz vor Beginn der Inquisition
erklärte ein spanischer Jude, daß die Könige von Kastilien gegenüber
ihren Feinden insofern im Vorteil seien, als ihre jüdischen Untertanen
zu den gebildetsten, vornehmsten, tugendhaftesten und wohlhabendsten
gehörten.7 In der Weimarer Republik, auf dem Höhepunkt von Integration
und Assimilation, hätten deutsche Juden ähnliches sagen können.
Selten hat es ein Zusammentreffen zweier kultureller (ethnischer oder
religiöser) Traditionen gegeben, das auf seinem Höhepunkt so
schöpferisch war. Wäre das Ende nicht so schrecklich gewesen, schreibt
Frederic Grunfeld, würde man die Jahrzehnte vor der Machtergreifung der
Nazis als ein Goldenes Zeitalter betrachten, das allenfalls von der
italienischen Renaissance übertroffen wurde.8
[ ... ]
Ihre eigentliche Heimat war, wie wir heute wissen, nicht »Deutschland«,
sondern die deutsche Kultur und Sprache. Ihre eigentliche Religion war
das bürgerliche Bildungsideal. Nicht weil sie sich für besser hielten,
sondern aus rein pragmatischen Gründen richteten sie ihre kulturellen
und politischen Bestrebungen – und ihre unbekümmerte Großmütigkeit – auf
den verzweifelten und letztlich vergeblichen Versuch, den deutschen
Patriotismus zu zivilisieren, auf einen durch Gesetze definierten und
nicht aufs Blut gegründeten Staat, auf eine Trennung von Kirche und
Staat, auf die Errichtung einer Gesellschaft, die man heute als offen,
verfassungspatriotisch und multikulturell bezeichnen würde. Es ist eine
tragische Ironie, daß jüdische Intellektuelle ausgerechnet während des
Ersten Weltkriegs – ohne den die Nationalsozialisten vermutlich nicht an
die Macht gekommen wären – zum einzigen Mal von ihren Bemühungen
abließen und in den europaweiten Hurrapatriotismus einstimmten.
Reportagen aus vier Jahrzehnten:
Nachrichten aus Jerusalem
Eine verzweifelte Flaschenpost aus Israel:
No Exit
"Macht keine Dummheiten, während ich tot bin":
Was ist falsch gelaufen?
hagalil.com
23-04-03 |