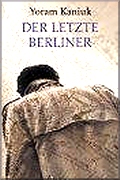
Yoram Kaniuk:
Der letzte Berliner
List Verlag 2002
Euro 18,00
Bestellen?
Mehr zu Juden und jüdischem Leben in Berlin |
Yoram Kaniuk:
Der letzte Berliner
Rezension von Daniel Jütte
Er ist der größte Partylöwe Berlins.
Er trägt am liebsten weiße Anzüge, hat blond gefärbtes Haar. Er schläft
jeden Tag mit einer seiner Tänzerinnen, ihm gehören Berlins bekannteste
Nachtclubs. Den Mann gibt es tatsächlich, er heißt Rolf Eden, sein
(Nacht-)Leben: Stoff genug für eine bissige Realsatire über Berlin und
dessen krampfhaft-glamouröse Halbwelt. Das Fernsehen filmt ihn mit
barbusigen Blondinen, Journalisten fragen den über Siebzigjährigen gerne
nach seiner Potenz.... Übrigens, er ist Jude, stammt sogar aus Israel.
Darüber hat ihn aber noch kein Journalist gefragt. So etwas gehört sich
nicht in Deutschland, über so etwas schreibt man auch nicht, höchstens
für irgend eine deutsch-nationale Postille.
Oder aber, man heißt Yoram Kaniuk. Und
was dabei rauskommt, wenn einer der bedeutendsten israelischen
Schriftsteller der Gegenwart mit bitterbösem Vergnügen das Geschirr im
Porzellanladen der deutsch-jüdischen Verklemmtheit zerschlägt, das kann
man in seinem jüngsten Buch "Der letzte Berliner" lesen: Eine Sektion
ohne Narkose an einem Patienten, dessen Wiederbelebung man in
Deutschland so oft beschworen hat, der deutsch-jüdischen Normalität. Der
Literat mit dem Skalpell schafft zu allererst Klarheit in der
Terminologie: eine deutsch-jüdische Normalität gibt es für Kaniuk nicht,
vielmehr eine bizarre Haßliebe zwischen Deutschen und Juden. Diese
durchaus nicht ganz neue Erkenntnis verdankt der Leser letztendlich
sogar dem Bundespräsidenten. Denn ohne dessen ausdrückliche - und
zunächst dreimal erfolglose - Einladung, hätte der israelische
Schriftsteller wohl nie einen Fuß auf deutschen Boden gesetzt, zum
ersten Mal Anfang der achtziger Jahre. Bis dahin kannte Kaniuk
eigentlich nur zwei Seiten von Deutschland: zum einen den
Eichmann-Prozeß und zum anderen die schwelgenden Erzählungen seines
Vaters, der in den dreißiger Jahren von Berlin nach Palästina
ausgewandert war und seitdem immer wieder vom Rhein und seiner
malerischen Landschaft schwärmte.
Fast 50 Jahre später sitzt sein Sohn also
auf Einladung des deutschen Staatsoberhauptes in einem
Erste-Klasse-Abteil der Deutschen Bahn und fährt -in Gedanken versunken-
durch das Rheintal. Plötzlich platzt ein junges, temperamentvolles Paar
in das Abteil, sieht sich um und läßt sich dann unter lautstarken
Freudebekundungen in die Sitze fallen -sie haben nämlich gar keinen
Erste-Klasse-Fahrschein. Das Abteil ist ansonsten leer, ihnen gegenüber
sitzt lediglich Kaniuk, ein Mann mit Brille, leicht ergrautem Haar und
einer Pfeife. Beide mustern den älteren Herrn aufmerksam und kommen dann
auf hebräisch zum gleichen Ergebnis: "Garantiert ein Nazi. Ein Monster".
Das "Monster" lauscht schweigend bis zum Zielbahnhof der ausführlichen
Musterung seiner Person, dann stellt es sich höflich auf hebräisch vor
und läßt zwei junge Israelis mit versteinerter Miene zurück.
Kaniuk jongliert meisterhaft mit
Anekdoten wie dieser, lakonisch und schonungslos schildert er Erlebnisse
aus seinen mittlerweile zwei dutzend Deutschlandreisen: Begegnungen mit
schuldgeplagten Kindern von NS-Größen, aber auch mit Alt-Nazis, die
Konfrontration mit Judenhassern und mit aufdringlichen Philosemiten bei
seinen Lesungen, seine Gespräche mit jenem israelischen Polizeichef, der
Eichmann monatelang verhörte, sich später in die Schweiz absetzte und
dort fortan an der Mythologisierung und historischen Entlastung
Eichmanns arbeitete.
Kaniuks authentische Schilderungen werden
immer wieder durch Reflexionen und Prosa-Miniaturen aufgelockert, so die
fiktive Geschichte des Gustav Vierundzwanzig, eines nach Palästina
geflohenen Berliners, der seinen Enkel Uri in Israel den Berliner
Stadtplan vom 28. November 1939 -dem Tag seiner Flucht- auswendig lernen
läßt. Uri, ein ganz normaler israelischer Junge, weiß bald, an welcher
Straßenecke es einen Bäcker gab, er kennt den Weg vom Kudamm zum
Savignyplatz und die Blumen, die an jenem Novembertag noch im Tiergarten
blühten. Sein Großvater macht ihn zum "Letzten Berliner", zum letzten
Zeugen einer untergegangenen Welt.
Auf solche leisen Geschichten läßt Kaniuk
immer wieder den literarischen Holzhammer folgen, für eine Verklärung
und Romantisierung der deutsch-jüdischen Vergangenheit ist bei ihm kein
Platz. Kaniuk liebt die Provokation, das Brechen von Tabus auf beiden
Seiten. Die israelischen Leser können das nur schwer verstehen: in
Israel ist das Buch immer noch nicht verlegt worden. In Deutschland
hingegen scheint für Kaniuk das Interesse an der
"Vergangenheitsbewältigung", jener selbstzerfleischend-lustvollen
Geschichtsbesessenheit, bis heute ungebrochen: wohl wahr, wie die Fälle
Möllemann und Walser gezeigt haben. Und ob die Deutschen heute wirklich
noch antisemitisch sind? Kaniuk hat da einen eigenwillige Standpunkt:
"Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen".
Diese Rezension erhielt 2002 den
ersten Preis beim Schüler-Rezensionswettbewerb "Preis junge Kritiker".
hagalil.com
27-01-04 |