|

Martin Jander:
Berlin (DDR).
Ein politischer Spaziergang
Ch. Links Verlag 2003
Euro 12,90
Bestellen?
Genau wie von der Mauer ist von den politischen
Machtzentren der DDR im Berliner Straßenbild kaum noch etwas zu
entdecken. Die meisten Gebäude sind inzwischen umgestaltet und werden
anders genutzt, manch neuer Eigentümer möchte auch nicht an die früheren
Hausherren erinnert werden.
Der politische Reiseführer "Berlin (DDR)" will dem entgegenwirken und
bietet einen Kurzeinstieg in die Geschichte des untergegangenen
ostdeutschen Staates anhand seiner markantesten Bauten. An jedem der 20
vorgestellten Orte wird ein Kapitel aus dem politischen Leben der DDR
knapp und anschaulich erzählt. Hinzu kommen Literaturverweise und
Servicedaten zur Erreichbarkeit, den Öffnungszeiten und den
Verkehrs-anbindungen. Zwei Übersichtskarten erleichtern das Auffinden
dieser interessanten Orte ostdeutscher Geschichte.
Politische Spaziergänge in Berlin:
unwrapping history |
Berlin (DDR):
Ein politischer Spaziergang
Von Martin Jander
Aufbau-Verlag
1956: Zerschlagene Hoffnung auf ein "Tauwetter"
Direkt am S-Bahnhof Hackescher Markt findet sich mit der
Adresse Neue Promenade 6 der "Aufbau-Verlag". Es ist einer der
Denkorte zur DDR-Geschichte, der sich nicht unbedingt als solcher zu
erkennen gibt. Buchstäblich nichts deutet auf die wichtige Geschichte
hin, die es hier zu bedenken gibt. Der neue Standort dieses Verlages -
ursprünglich residierte er in der Nähe des Gendarmenmarktes in der
Französischen Straße 32 - liegt jedoch für den Berlintouristen ganz
ausgezeichnet. Man erreicht viele andere Sehenswürdigkeiten in der
Umgebung - z. B. die Synagoge in der Oranienburger Straße 28-30 - von
hier aus sehr schnell. Nur ein paar Schritte entfernt, in den Hackeschen
Höfen
Rosenthaler Straße 40/41, findet man die auf Berlin-Literatur
spezialisierte Buchhandlung und Galerie "artificium". Darüber hinaus
sind der Platz vor dem S-Bahnhof Hackescher Markt und seine Umgebung
sehr beliebt, die Cafes, Restaurants, Bars, Kinos und viele angenehme
Dinge mehr bietet.
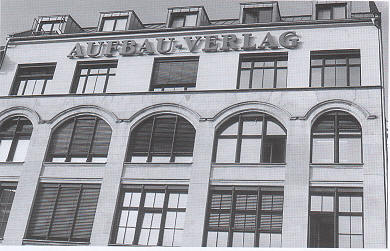
Das neue Gebäude des Aufbau-Verlages in der Neuen
Promenade 6, direkt am S-Bahnhof Hackescher Markt. Die Fassade wurde in
den 90er Jahren denkmalsgerecht saniert.
Der Verlag wurde am 16. August 1945 vom Dichter und
späteren Kulturminister der DDR Johannes R. Becher im Auftrag des
"Kulturbundes zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands" gegründet.
Hier erschien Anna Seghers' berühmter Roman "Das siebte Kreuz" und
Theodor Pliviers "Stalingrad". Ernst Bloch, Lion Feuchtwanger, Egon
Erwin Kisch, Hans Fallada, Victor Klemperer, Arnold Zweig und Georg
Lukäcs gehörten zu den frühen Autoren des Verlages, der ein
vergleichsweise offenes Programm hatte.

Das Signet des Verlages über dem Eingangstor.
Am 6. Dezember 1956 wurde der damalige Leiter Walter
Janka in den Räumen des Verlages verhaftet. Bereits einige Tage vorher
war der Philosophiedozent und Lektor des Verlages Wolfgang Harich
inhaftiert worden. Außerdem verhaftete man: Manfred Hertig
(Redaktionssekretär der "Deutschen Zeitschrift für Philosophie"), Heinz
Zöger, Gustav Just (Redakteure der Kulturzeitschrift "Sonntag"), den
Ökonom Bernhard Steinberger und den Rundfunkkommentator Richard Wolf.
Alle zusammen wurden in zwei getrennten Prozessen vor dem Obersten
Gericht der DDR im März und im Juli 1957 der konspirativen Verschwörung
gegen die DDR angeklagt. Im Urteil gegen Walter Janka hieß es, dass die
Gruppe eine Veränderung der gesetzlich geschützten gesellschaftlichen
Verhältnisse der DDR angestrebt habe. Es sei beabsichtigt gewesen, die
Wirtschaftsplanung und die gesellschaftliche Struktur der Deutschen
Demokratischen Republik zu ändern.
Eine von Harich ausgearbeitete politische Plattform über
einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus, verschiedene Treffen
Harichs mit Vertretern des SPD-Ostbüros in Westberlin, seine Vorsprachen
beim sowjetischen Botschafter in Deutschland und bei Ulbricht selbst
sowie eine Zusammenkunft der ganzen Gruppe am 21. November 1956 mit dem
1952 inhaftierten, im Juli 1956 aber wieder rehabilitierten ehemaligen
Politbüromitglied Paul Merker, bei der auch über eine Absetzung
Ulbrichts gesprochen worden war, bildeten den Gegenstand der Anklage.
Harich galt der Staatssicherheit als Kopf, Janka als Organisator der vom
Gericht unterstellten Verschwörung.
Strafrechtlich war die Anklage verfehlt, denn das
Vorhaben war nicht konspirativ vorangetrieben worden. Die Angeklagten
strebten eine öffentliche Auseinandersetzung in der SED und der DDR zur
Überwindung des Stalinismus an und erwarteten (vergeblich) Unterstützung
sogar von Kulturminister Johannes R. Becher. Jankas Verteidiger
Friedrich Woiff forderte deshalb auch konsequent den Freispruch seines
Mandanten.
Politisch allerdings konnte es keinen Zweifel daran
geben, dass die Angeklagten eine Revision der Politik der SED angestrebt
hatten. In der DDR wollten sie eine Reform mit und durch die SED; ein
neuer 17. Juni sollte vermieden werden. Außenpolitisch war langfristig
an eine friedliche Wiedervereinigung Deutschlands auf der Grundlage von
Demokratie, Sozialismus und nationaler Souveränität gedacht, nach
Zwangsvereinigung und Verfolgung von Sozialdemokraten in der DDR sollte
ein neuer Anfang in der Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten und
Gewerkschaftern der Bundesrepublik gemacht werden. Der Plan der
Harich-Janka-Gruppe bildete deshalb, neben der Stalin-Note von 1952, die
eine Vereinigung beider deutscher Staaten unter der Bedingung ihrer
Neutralität vorschlug, nicht umsonst bis heute Material für Kontroversen
über die "verpassten" Chancen deutscher Einheit vor dem Mauerfall 1989.

Von 1945 bis 1992 hatte der Aufbau-Verlag sein Domizil
in der Französischen Straße 32. Hier wurde Verlagsleiter Walter Janka im
Dezember 1956 an seinem Schreibtisch verhaftet.
Die von Harich verfasste Plattform der Gruppe enthielt
folgende Punkte: "Umstellung der Produktion auf die Erhöhung des
Lebensstandards nach dem Vorbild des neuen Kurses", "Gründung von
Arbeiterräten, Gleichstellung und Förderung der mittelständischen
Industrie". Außerdem wollte man eine "Auflösung der landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften und die Entwicklung eines gesunden Klein-
und Mittelbauerntums". Ohne alle Schnörkel wurde die "Wiederherstellung
der Geistesfreiheit und der Autonomie der Universitäten, die Beendigung
des Kirchenkampfes, eine Auflösung des Staatssicherheitsdienstes und die
Garantierung der Rechtssicherheit" gefordert. Darüber hinaus verlangte
man die Erweiterung des Parteienspektrums unter der Führung einer
reformierten SED, Aufstellung von Wahllisten mit mehreren Kandidaten,
die Wiederherstellung der Souveränität des Parlaments und eine
durchgreifende Entbürokratisierung des gesamten Verwaltungsapparates.
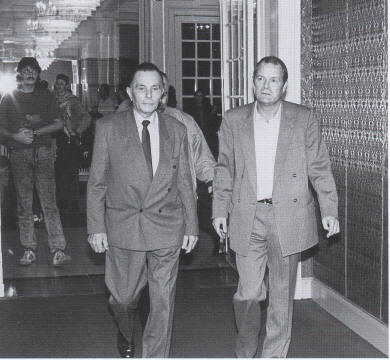
Der Intendant des Deutschen Theaters, Dieter Mann,
organisierte im Oktober 1989 eine öffentliche Lesung mit Walter Janka
(links), die eine Debatte über die stalinistischen Praktiken der SED
auslöste.
Eine reformierte SED sollte dann mit der westdeutschen
SPD zusammenarbeiten: "Uns trennt von der SPD gegenwärtig zwar vieles
(bürgerlich-demokratische Illusionen, Tendenzen zum Opportunismus usw.),
aber vor allem trennt uns von der SPD der Stalinismus. Darum muss sich
die SED vom Stalinismus trennen, bevor eine Zusammenarbeit mit der SPD
wirklich ehrlich möglich werden kann." Außerdem wurde die "Entwicklung
einer Außenpolitik" angestrebt, "die an dem Bündnis mit dem
sozialistischen Lager bei Wahrung der völligen Unabhängigkeit und
Gleichberechtigung festhält."
Den Hintergrund der Überlegungen der Gruppe bildete der
Beginn des so genannten Tauwetters in Osteuropa. Nach Stalins Tod, im
März 1953, und nach dem XX. Parteitag der KPdSU, im Februar 1956, auf
dem Chruschtschow in einer Geheimrede viele Verbrechen der Stalin-Ära
benannt hatte, war in ganz Osteuropa ein Prozess von Rehabilitierungen
und politischer Liberalisierung zu erkennen. Der Text der Rede wurde in
der Sowjetunion auf Parteiversammlungen nur laut vorgelesen, ist jedoch
wenige Wochen später im Westen publiziert worden. Während in Polen am
20. Oktober 1956 der lange Jahre inhaftiert gewesene Nationalkommunist
Gomulka zum Chef der Kommunistischen Partei gewählt wurde und am 23.
Oktober desselben Jahres in Ungarn ein Aufstand gegen die bisherigen
Machthaber begann, der von Truppen der Sowjetunion am 11. November
brutal niedergeschlagen wurde, blieb es in der DDR nach den Erfahrungen
des 17. Juni 1953 eher ruhig, zumal es einige Zugeständnisse der
Führung, wie die Entlassung von 25 000 Häftlingen, gab. Lediglich
Intellektuelle forderten offen eine Veränderung der Verhältnisse.
Dem Leiter des Aufbau-Verlages Walter Janka war es nicht
ins Stammbuch geschrieben worden, dass er mit seiner Partei in Konflikt
geraten sollte. Er war 1914 in Chemnitz in eine kommunistische Familie
hineingeboren worden und sah sich bis fast bis zu seinem Tod 1994 als
Kommunist. Weder seine Haft bei den Nationalsozialisten seit 1933 noch
die Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco, auch nicht das
Exil in Mexiko und nicht die Erfahrung mit der SED-Diktatur seit 1945
ließen Janka mit seiner ursprünglichen kommunistischen Orientierung
hadern.
Janka, der im Exil in Mexiko den legendären Verlag "El
Libro Libre" aufgebaut und geleitet hatte, in dem weltberühmte Bücher
von Heinrich Mann, Anna Seghers und Egon Erwin Kisch erschienen waren,
beschreibt in seiner Autobiographie - "Schwierigkeiten mit der Wahrheit"
(Hamburg 1989) -, dass es vor allem die Untersuchungshaft, der Prozess
vor dem Obersten Gericht der DDR und die spätere Haft in Bautzen waren,
die bei ihm tiefe Zweifel über den Sozialismus und die Richtigkeit
seiner Entscheidungen auslösten. Janka wurde nicht nur aus der Partei
geworfen, sondern man erkannte ihm zusätzlich auch seine Rente als
Verfolgter des Naziregimes ab.
Der Kopf der Gruppe, Wolfgang Harich, bestätigte im
Prozess - zur Überraschung Jankas - die Verschwörungsversion der Anklage
in weiten Zügen und bedankte sich beim Ministerium für Staatssicherheit
sogar ausdrücklich dafür, dass man ihn "gestoppt" habe. Er stellte sich
im Prozess gegen Janka als Kronzeuge zur Verfügung. Dieser Auftritt ist
ihm später nicht verziehen worden. Auch seine als Widerspruch zu Jankas
Erinnerungen angelegten autobiographischen Bücher - "Keine
Schwierigkeiten mit der Wahrheit" (Berlin 1993) und "Ahnenpass. Versuch
einer Autobiographie" (Berlin 1999) - haben daran nichts geändert.
Janka kam 1960 aus dem Gefängnis in Bautzen und konnte
nach Intervention von Freunden bis 1972 als Dramaturg bei der DEFA
arbeiten. Die Existenz der DDR hielt er - als Alternative zur
kapitalistischen Bundesrepublik - trotz allem für eine Notwendigkeit.
Nur wollte er sie demokratisieren und die stalinistisch geprägten
Strukturen überwinden. Davon zeugt auch seine Autobiographie, die im
Sommer 1989 im Hamburger Rowohlt-Verlag erschien. Zwei Lesungen daraus,
am 28. Oktober im Deutschen Theater und ihre Übertragung im Rundfunk der
DDR, waren wesentliche Ereignisse des Umbruchs 1989 in der DDR. Eine
öffentliche Debatte über die offen terroristische Phase der SED-Diktatur
war damit unüberhörbar angestoßen.
Weiterführende Literatur:
Brigitte Hoeft (Hrsg.): Der Prozess gegen Walter Janka und andere.
Eine Dokumentation. Reinbek 1990; Walter Janka: Spuren eines Lebens.
Berlin 1991; Wolfgang Harich: Ahnenpass. Versuch einer Autobiographie.
Berlin 1999; Carsten Wurm (Hg.): Jeden Tag ein Buch - 50 Jahre Aufbau
Verlag. Berlin 1995.
Aufbau-Verlagsgruppe
Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Neue Promenade 6
10178 Berlin
Tel.:28394-0
Fax:28394-100
E-Mail: presse@aufbau-verlag.de
Internet; www.aufbau-verlag.de
Verkehrsverbindung: Der Aufbau-Verlag hat seinen Sitz
unmittelbar am S-Bahnhof Hackescher Markt.
artificium - Kunstbuch und Galerie
Rosenthaler Straße 40/41
(in den Hackeschen Höfen, Hof 2)
10178 Berlin
Tel.: 30 8722 80
Internet: www.artificium.com
Verkehrsverbindung: Die Hackeschen Höfe befinden sich nur
einige Schritte entfernt vom S-Bahnhof Hackescher Markt. |
Bestellen?
Politische Spaziergänge in Berlin:
unwrapping history
hagalil.com
27-06-04 |