|
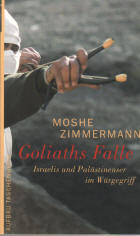
Moshe Zimmermann:
Goliaths Falle.
Israelis und Palästinenser im Würgegriff
Aufbau Tb Verlag 2004
Euro 8,50
Bestellen?
Goliaths Falle
Die neue Auflage des
Antisemiten-katechismus
Massada-Zionismus |
Das Erbe von Oslo
Moshe Zimmermann
13. September 2003 (Tages-Anzeiger)
Während die Welt der Anschläge auf das World Trade
Center in New York am 11. September gedenkt, steht in Israel ein anderer
Gedenktag an: der zehnte Jahrestag der Osloer Abkommen vom 13. September
1993.
Oslo - das ist außerhalb des Nahen Ostens ein Synonym für
den entscheidenden Durchbruch, für die große Hoffnung auf ein Ende des
hundertjährigen Krieges zwischen Juden und Arabern in Israel und Palästina.
In der Region selbst ist Oslo dagegen eher zum Symbol für Versagen und
Verrat geworden. Seit Jahren spricht die radikale israelische Rechte von den
"Oslo-Verrätern". Vor allem nach dem Beginn der Intifada im Herbst 2000 hat
sich dieser Begriff so einbürgern können, daß die Mehrheit der Bevölkerung
bei "Oslo" automatisch zumindest an eine große Torheit — wenn nicht gar an
Verrat - denkt.
Einer Meinungsumfrage zufolge glauben vierzig Prozent der
Israelis, die Osloer Abkommen hätten einen irreparablen Schaden angerichtet
oder seien zumindest ein Fehler gewesen, der korrigiert werden sollte. Nur
zwanzig Prozent der Bevölkerung meint, Oslo sei eine vergebene Chance des
Durchbruchs gewesen. Die Hälfte der Israelis nimmt an, daß Oslo auch ohne
die Ermordung Izhak Rabins im November 1995 gescheitert wäre; dies
vermutlich deswegen, weil man der Ansicht ist, Palästinensern dürfe
prinzipiell kein Glauben geschenkt werden. Diese Hälfte der Israelis hält
einen Frieden mit den Palästinensern denn auch im wesentlichen deshalb für
unerreichbar, weil sie auf palästinensischer Seite eine fehlende
Bereitschaft zur Anerkennung Israels wahrnehmen möchte. Entsprechend gehen
mehr als fünfzig Prozent davon aus, daß es selbst im Falle der Errichtung
eines palästinensischen Staates im Jahre 1999 - gemäß den Vereinbarungen von
Oslo - heute keinen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern gäbe.
Nicht nur der Zusammenhang von Terror und Vergeltung,
sondern auch die eindeutig negative Assoziation »Oslos« seitens der
Palästinenser bringt die typische Symmetrie zwischen Israelis und
Palästinensern zum Ausdruck: Aus palästinensischer Sicht war Oslo ein
Täuschungsmanöver Israels, mit dem die erste, im Dezember 1987 begonnene
Intifada erstickt und ein Verzicht auf den Anspruch der Palästinenser auf
das gesamte Gebiet von Palästina erzwungen werden sollte. Die Israelis, so
heißt es unter Palästinensern, hätten von Anfang an keine ehrlichen
Absichten gehegt, das Großunternehmen des Siedlungsbaus zu beenden und die
Entstehung eines Staates Palästina zu ermöglichen.
Der Schlüssel für den Mißerfolg ist das "Vertrauen". An
diesem Begriff scheiterte Oslo. Statt über vertrauensbildende Maßnahmen
bestehende Vorurteile zu beseitigen und den Weg zur Implementierung der
Vereinbarungen zu ebnen, schuf man neue Hürden und untermauerte die
stereotypen Vorstellungen von der jeweils "anderen" Gesellschaft. Für dieses
Debakel trägt der mächtigere Partner-Israel - eine größere Verantwortung:
Die Ermordung Izhak Rabins, die Politik seiner Nachfolger Netanyahu und
Barak gegenüber den Palästinensern und nicht zuletzt die Provokation des
damaligen Oppositionsführers Ariel Sha-ron im Herbst 2000 erdrosselten den
Osloer Prozeß und konnten das Mißtrauen der Palästinenser nur verstärken.
Andererseits waren es die radikalen Palästinenser, die zum
wahllosen Terror griffen - ganz gleich ob die Ministerpräsidenten in Israel
Rabin, Perez, Netanyahu, Barak oder Sharon hießen - und auf diese Weise das
Vertrauen der Mehrheit der Israelis in den Osloer Prozeß gründlich
erschütterten. Darüber hinaus wirkte Yassir Arafats Art der Innen- und
Außenpolitik auf die meisten Israelis geradezu abstoßend.
Kompromißbereitschaft beider Konfliktparteien und
Großzügigkeit bei den Israelis waren unter diesen Umständen kaum möglich. So
fühlen sich letztlich die radikalen Kräfte auf beiden Seiten immer mehr
bestätigt und gewinnen unter der breiten Bevölkerung zunehmend an
Unterstützung. Daß ihr Weg in den Abgrund führt, will man nicht zur Kenntnis
nehmen. Als Hauptsache gilt, man agiert, man übt Vergeltung, man gibt nicht
auf.
Irrelevant ist in diesem Zusammenhang der 11. September
jedoch keineswegs. "Oslo" stand im Zeichen des Endes des Kalten Krieges. Die
bipolare Welt hatte aufgehört zu existieren, was ebenfalls zu einer
"Abwertung" der israelisch-arabischen Auseinandersetzung führte. Der
"globale Polizist" - die Vereinigten Staaten - konnte mit Hilfe Rußlands,
und damit ohne einen Gegner, eine neue Ordnung im Nahen Osten anstreben.
Diese Konstellation währte jedoch nur vom November 1989 bis zum September
2001. Dann hatten sich die Spielregeln erneut geändert, Amerika hatte einen
neuen Feind gefunden.
Die palästinensische Intifada konnte so, wie sie geführt
wurde, eindeutig als Terror gebrandmarkt werden. In dem Kreuzzug gegen den
Terror standen "die Palästinenser" alsbald auf der "falschen Seite" der
Achse von Gut und Böse, während der Hardliner Ariel Sharon zum treuesten
Verbündeten der Vereinigten Staaten wurde. Und hinter Sharon steht die
mächtigste Pressuregroup Israels - die Siedler. Bei den Palästinensern stieg
in der Folge um so mehr die Hoffnungslosigkeit und mit ihr die
Gewaltbereitschaft: Fünfzig Prozent Arbeitslosigkeit und ständige
Demütigungen sind ein verheerendes Rezept für uferlose Gewalt.
Die sich verbreitende Überzeugung, an allem trügen die
Väter von Oslo Schuld, führt jedoch zu keiner Lösung. Die Frustration
steigt, und alle fragen verzweifelt, was werden wird. Da man jedoch den
Erben des Osloer Prozesses keinen Glauben mehr schenkt, führt diese
Verzweiflung nicht zur Stärkung der Opposition aus Befürwortern von Oslo,
sondern zum Verlangen nach einem noch härteren Durchgreifen, gewissermaßen
nach dem Motto, wenn es uns schlecht geht, dann soll es den anderen noch
schlechter gehen.
Eine Alternative, vor der furchtbaren Situation nur die
Augen zu schließen, ist die Flucht in die Ablenkung - panem et circenses.
Allerdings ist es auch mit dem Brot nicht weit her, denn die Wirtschaftslage
in Israel ist ganz besonders schlecht. Die Bekämpfung der Intifada
verschlingt Milliarden und verursacht weitere Verluste in Milliardenhöhe.
Statt jedoch die Verantwortlichen - die Siedler und ihre jedem Kompromiß im
Wege stehende Politik - zur Kasse zu bitten, flüchtet man sich in die
Spiele: Fernsehserien, Reisen, Lotto, Heiligenverehrung und Sport.
Wenn man nur einen israelischen Roger Federer gehabt
hätte. Aber nein, schon in der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft hat
Israels Elf gegen das kleine Slowenien verloren und gegen die Mannschaft von
Malta nur ein Unentschieden erzielt. Für viele - beinahe schlimmer als ein
Terroranschlag. Und nach einem schlechten Einstieg in die
Basketball-Europameisterschaft hat Israel zwar Slowenien (ja, wieder
Slowenien) schlagen und das Viertelfinale erreichen können. Gegen Spanien
konnte man jedoch nichts ausrichten. So wird wieder der andere, unsportliche
Wettbewerb in den Vordergrund rücken, der Wettkampf des Tötens, in dem man
in der nächsten Runde wohl auch vor einem Zugriff auf die politische Spitze
des Gegners nicht zurückschrecken wird.
hagalil.com
04-11-04 |