|
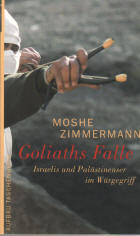
Moshe Zimmermann:
Goliaths Falle.
Israelis und Palästinenser im Würgegriff
Aufbau Tb Verlag 2004
Euro 8,50
Bestellen?
Goliaths Falle
Massada-Zionismus
Das Erbe von Oslo |
Gebrauchsanweisungen für Israel-Kritiker
Oder:
Die neue Auflage des Antisemitenkatechismus
Moshe Zimmermann
24. Mai 2002 (Süddeutsche Zeitung)
Zwei Fragen machen viele Deutsche ratlos: Wird ihr
Land tatsächlich von einer Flut des Antisemitismus überschwemmt? Dürfen
wir uns über Israel nicht kritisch äußern, weil uns dann automatisch
Antisemitismus vorzuwerfen ist? Schüchtern wird nach einer klaren Grenze
zwischen legitimer Kritik und Antisemitismus gesucht, nach einem
eindeutigen Warnsignal bei Grenzüberschreitungen. Als
Antisemitismusforscher und Israel-Kenner zugleich stelle ich den
folgenden Katechismus zur Verfügung.
F. Was ist eigentlich Antisemitismus?
A. Ein Begriff, der im Jahre 1879 von einem Deutschen erfunden wurde,
um den nicht mehr salonfähigen Begriff "Judenfeindschaft" oder
"Judenfresser" zu ersetzen. Antisemit ist einer, der aufgrund eines
Vorurteils "die" Juden - als vermeintliche Rasse, Nation,
Religionsgemeinschaft oder soziale Gruppe - pauschal negativ bewertet
und daraus im relevanten Fall auch soziale oder politische Konsequenzen
zieht.
F. Kann ein Araber Antisemit sein?
A. Ja. Es gibt ja keine semitischen Völker. Mit dem Begriff
"Antisemit" wollte man von Anfang an nur Juden angreifen. Ein arabischer
bzw. muslimischer Antisemitismus ist also nicht ausgeschlossen.
F. Was kann einen Araber zum Antisemitismus bringen?
A. In der muslimischen Tradition gibt es zwar ansatzweise auch eine
pejorative Haltung gegenüber Juden. Doch erst seit Beginn des
arabisch-zionistischen Konflikts bedienten sich Araber im Nahen Osten
der vorrangig aus Europa importierten antisemitischen Argumente und
Bilder, quasi als Schützenhilfe im neuen, akuten Kampf. Dieser arabische
Antisemitismus hat den paradoxen Weg zurück nach Europa gefunden, wo
heute beträchtliche arabische Minderheiten leben. Angriffe in Wort und
Tat gegen Juden, die aus diesen Kreisen kommen - man macht "die" Juden
für israelische Taten und Untaten verantwortlich —, stehen gegenwärtig
im Mittelpunkt des Antisemitismus in Europa.
F. Was erklärt diese gegenwärtige Welle des
Antisemitismus?
A. Die aktuelle Situation im Nahen Osten. Die
Reaktion auf Israels Verhalten während der Intifada verwandelt die
ursprünglich antiisraelische Haltung in einen Antisemitismus. Ein
Anschlag auf eine Synagoge - in Frankreich oder in Tunesien - ist ein
antisemitischer Akt, auch wenn sich dahinter eine trotzige Reaktion auf
die israelische Politik verbirgt. Die Zahl solcher Angriffe seit Oktober
2000 spricht eine deutliche Sprache.
F. Gilt diese Regel nicht auch für "autochthone"
Europäer?
A. Gewiß. Die antisemitische Tradition hat sich zwar in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa abgeschwächt, aber der Konflikt im
Nahen Osten (und besonders die zweite Intifada) dient als Ansporn und
Rechtfertigung auch für "autochthone" Europäer, ihre antisemitischen
Vorurteile im neuen Zusammenhang zu reaktivieren. Wer die Sympathien von
Antisemiten für sich gewinnen will oder sich auf Stimmenfang
antisemitischer Wähler im politischen Wahlkampf befindet, der kann es
entweder über die Verwendung des antisemitischen Diskurses tun oder
Menschen aus der nicht "autochthonen" Gruppe unterstützen, die
antisemitische Narrative und Bilder verwenden. Wer das tut, ist selbst
Antisemit oder Mitläufer. Dafür muß man kein Rechtsradikaler von heute
oder ein "neuer Linker" von vor 30 Jahren sein.
F. Gibt es dann keine Kritik an israelischer Politik,
ja keine Kritik an Israel, die nicht automatisch als Antisemitismus zu
werten ist?
A. Jede ehrliche Kritik, die auf Sachkenntnissen beruht, ohne von
judenfeindlichen Stereotypen und Pauschalisierungen Gebrauch zu machen
oder latente antisemitische Sentimente heraufbeschwören zu wollen, ist
nicht, kann nicht antisemitisch sein und ist deshalb legitim. Nicht nur,
wenn sie in Israel zum Ausdruck kommt, sondern auch in Europa, ja sogar
in Deutschland.
F. Es ist verhältnismäßig einfach, den "klassischen"
Antisemiten zu entlarven: Er denkt noch immer, daß man Juden vergasen
darf, oder zumindest "loswerden" muß, leugnet im selben Atemzug
Auschwitz, spricht offen von einer "jüdischen Weltverschwörung" oder von
jüdischer Geldgier, will dazu keine Juden in seiner Nachbarschaft oder
im Klub haben. Woran erkennt man jedoch den Antisemiten-Wolf im
Israel-Kritiker-Schafspelz?
A. Eben an den Assoziationen, die der Kritiker heraufbeschwört, an den von
ihm gewählten Angriffszielen und nicht zuletzt an seiner eigentlichen
Absicht. Erstens geht es um die Assoziationswelt des Israel-Kritikers.
Die Sprache ist ja die Mutter aller Assoziationen: Wird Shylok, Judas
oder Der Stürmer im Zusammenhang mit dem Thema Israel erwähnt, wird von
Deutschen vs. Juden gesprochen, wird hinter dem deutschen Juden der
Auslandisraeli vermutet, wird von "Auge um Auge"-Mentalität gesprochen,
werden der stereotype "reiche Jude", der "Kosmopolit" oder das
"Weltjudentum" in die Diskussion hineingezogen, kommt in der Karikatur
die "jüdische" Nase oder der Hinweis auf Ritualmord zum Vorschein - dann
befindet man sich bereits im Bereich des Antisemitismus, weit über die
legitime Sharon- oder Israel-Kritik hinaus.
Zweitens geht es um die Gruppe, gegen die die Kritik geäußert wird: Wenn
es sich nicht um den spezifischen Politiker (israelischen oder auch
deutschen) oder um die spezifische Organisation (auch wenn sie
"Jüdischer Weltkongreß" heißt) handelt, sondern um den vermeintlichen
Vertreter "des" Judentums oder "der" Juden, wenn nicht an israelische,
sondern an jüdische Charakteristiken gedacht wird, sind wir bereits beim
Antisemitismus angelangt.
Und drittens, vielleicht noch wichtiger: Auf die Absicht kommt es an. Ein
und derselbe Satz oder Ausdruck können unterschiedliche Intentionen
haben. Sogar Vergleiche mit dem Nationalsozialismus erhalten so eine
unterschiedliche Bedeutung: Ein Vergleich kann auf die Unterschiede
abzielen, er kann einer Mahnung dienen, er kann aber auch eine
Verharmlosung oder Relativierung des Nationalsozialismus beabsichtigen
oder die Delegitimierung des Judentums. Ob es sich um eine
antisemitische Absicht eines Israel-Kritikers handelt, kann man meist
nur indirekt erfahren, wenn man die Denkweise des Kritikers oder die
Adressaten dieser Vergleiche und historischen Anspielungen kennt. Die
vor etwa 15 Jahren gefallenen Äußerungen des Historikers Ernst Nolte
bieten dafür ein typisches Beispiel. In der Regel braucht der Beobachter
jedoch viel Fingerspitzengefühl.
F. Können Juden nicht selbst Antisemitismus schüren?
A. Nein. Aber auch Juden können dazu beitragen, daß latente
Antisemiten sich outen. Ohne das bereits vorhandene antisemitische
Vorurteil hätte das Wort oder die Tat eines Juden nicht die auf Juden
bezogene Reaktion heraufbeschworen. Wenn zum Beispiel jemand sowohl
jüdisch als auch proisraelisch, Parteimitglied, Medienmensch etc. ist
und gerade wegen seines Jüdischseins angegriffen wird, ist
wahrscheinlich Antisemitismus im Spiel.
F. Ist der Aufschrei "Wolf, Wolf, Antisemitismus!"
unter Juden nicht oft übertrieben?
A. Heute ist Auschwitz aus den Köpfen nicht mehr wegzudenken.
Auschwitz macht viele Juden zu Paranoiden.
F. Erklärt das auch die israelische Überreaktion beim
eigentlichen oder vermeintlichen Antisemitismus?
A. Nur teilweise. Für die israelische Politik der letzten 25 Jahre
gilt jeder Hinweis auf Antisemitismus, gleich, ob im Nahen Osten oder in
Europa, als Bestätigung der im Zionismus verbreiteten Vermutung, daß der
Antisemitismus ubiquitär und ewig ist und Israel deshalb vom Nachdenken
über seine Ideologie und Politik- gegenüber Palästinensern, israelischen
Arabern, linken "Verrätern" etc. - freigestellt sei. Versteht man die
Welt so, ist in den eigenen Augen alles, was Israel tut, legitim, quasi
um einem neuen Auschwitz vorzubeugen. (Auch der Mossad schuf die absurde
Abteilung zur Abwehr des Antisemitismus.) Kurz: Der gegenwärtige
Antisemitismus dient just der israelischen Politik, die ehrliche
Israel-Kritiker verurteilen.
hagalil.com
04-11-04 |