
Yitzhak Laor:
Steine, Gitter, Stimmen
Unionsverlag 2003
Euro 22,90
Bestellen?
Leseprobe
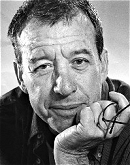
Foto Itay Ben-Ezra
"Laors Buch ist in jeder literarischen Hinsicht
bedeutender als die Bücher von Grossman und Shalev. Israels
Literatur-establishment kann keinen Einfluss auf die ewigen Jagdgründe
der Bestseller haben, aber es sollte das, was vom öffentlichen
Literaturdiskurs übrig geblieben ist, auf Yitzhak Laors neues Buch
richten."
Amnon Navot, Ma'ariv, Tel Aviv
"Dieser Roman ermöglicht eine einzigartige
Leseerfahrung. Er ist bewegend, macht wütend, überschreitet Grenzen. Er
ist ebenso witzig wie erschreckend in seinem abgründigen Humor, zügellos
und zugleich verblüffend strukturiert." Avi Katz, Ha'aretz, Tel Aviv
Yitzhak Laor:
Ecce homo
Eine Odyssee durch Tel Aviv zur Zeit des zweiten
Golfkriegs: Adam Lotem, General der israelischen Armee, ist auf der
Suche nach den Bildern von Luca Signorelli und nach der geheimnisvollen
Shulamit, der er in der Bibliothek der Universität begegnet und die sich
ihm immer wieder entzieht... |
Literatur aus Israel:
Yitzhak Laors "Steine, Gitter, Stimmen"
Markus Lemke, Übersetzer
Gutachten zum Roman
Unionsverlag
Kaum ein Roman könnte sich widerborstiger sperren, in
gedrängter Form subsumiert zu werden, zumal in Form einer Inhaltsangabe.
Laors hochkomplexes Kunstwerk ermöglicht es dem Leser nicht ohne
weiteres, einen geordneten Handlungsstrang herauszulösen, auch nicht
derer zwei oder drei. Vielmehr erinnert der Roman an ein pausenloses
Abbrennen narrativer bengalischer Feuer, eine unüberschaubare Vielzahl
angerissener, sich verbindender, überschneidender, widersprechender,
gegenseitig ausschließender, revidierender Geschichten. (...)
Ironischerweise lassen sich jedoch bei all dem – wenn der
Leser denn darauf besteht – Überreste filtrieren einer Story, die so
etwas wie einen Anfang und ein Ende hat, ein grotesk entstellter
Bestsellerplot, ein nahöstlicher Geheimdienstthriller um einen (Anti-)
"Helden": Vielleicht heißt der Mann Jizchak, Jizchak Kummer: Ein
hochrangiger Offizier des Inlandsgeheimdienstes SHABAK, übergewichtig,
mit Brille und Narbe hinter dem Ohr, der zum Islam übergetreten und von
seinem letzten Einsatzort Gaza nichtabgemeldet verschwunden ist, nachdem
ihm ein wichtiger palästinensischer Häftling, ein Informant, abhanden
gekommen ist. Wie auch immer – Kummer verliert seine Identität, seinen
Glauben, sein Vertrauen in die Menschen, vielleicht auch seinen
Verstand. Mit Beginn des Libanonkriegs ist er in Tel Aviv und hält mit
seinem Renault schrittfahrend eine Panzertransporterkolonne auf dem Weg
zur Nordgrenze auf, bis er schließlich in eine landwirtschaftliche
Siedlung im Zentrums des Landes gelangt, wo er eine Anstellung als
Lehrer findet und die Suche nach seinem entkommenen arabischen
Informanten, der ihn verraten hat und für einen Anschlag verantwortlich
ist, fortsetzt.
Vielleicht ist ja Nissim, der gebildete, belesene
Schuldiener, sein Mann, ist er der "Stinker" Ismail, der seine Frau mit
ihren drei Kindern in einem Flüchtlingslager zurückgelassen hat. Aber
vielleicht ist er auch der Bruder des Lehrers, oder vielmehr sein
Halbbruder wie der biblische Ismail ein Halbbruder von Isaak/Jizchak? Am
Ende verschwindet der Lehrer, führt vielleicht als der Mahdi Muhammad
Bashi Utrak (unter dem Namen des zum Islam übergetretenen falschen
Messias Sabbatai Zwi) die Kinder der Flüchtlingslager zurück auf ihr
Land, während Nissim in einem israelischen Gefängnis landet und seinen
Mitinsassen aus "Kalila und Dimna" vorliest, einem persischen
Heldenepos.
Vor allem jedoch liest sich der Roman wie ein Versuchslabor
für die Willkürlichkeit der menschlichen Identität. Eine Vielzahl von
Personen hören auf denselben Namen (...). Andere wechseln ebenso ihren
Namen wie ihr Geschlecht, ein literarisches Experiment, das seine
Höhepunkte in Gefängnissen und Verhörräumen des israelischen
Geheimdienstes findet, wo unter Folter Name, Identität, Lebensgeschichte
und einfache, gewünschte Antworten geformt werden.
Bei all dem hat Yitzhak Laors Roman nichts von
post-modernistischer Entfremdung – er kommt (überraschenderweise) immer
wieder anrührend und geradezu sentimental daher, komisch, grotesk, nicht
selten brutal und abstoßend obszön, doch immer schillernd bunt und
gewagt.
Der Autor:
Yitzhak Laor wurde 1948 in Pardes Hanna, Israel, geboren.
Sein Vater immigrierte 1934 aus Bielefeld, Deutschland, nach Israel,
seine Mutter aus Riga, Lettland. Laor ist Dichter, Bühnenautor,
Romancier und Journalist. Er studierte Literatur und unterrichtete an
der Universität von Tel Aviv an den Fakultäten für Theater und Film und
später an der Jerusalemer Filmschule. Regelmäßig veröffentlicht er
Literaturrezensionen in der israelischen Tageszeitung Ha'aretz, zudem
schreibt er journalistische Essays über Kultur, Gesellschaft und Politik
(z.B. für London Review of Books oder New Left Review).
Als Dienstverweigerer wurde er 1972 verhaftet, weil er sich
weigerte, in den besetzten Gebieten Dienst zu leisten. Seine
kriegskritischen Gedichte und Romane brachten ihm seit den
Achtzigerjahren viel Kritik, aber auch Lob ein. Sein Theaterstück
"Ephraim kehrt zur Armee zurück" parodiert den Antiheldenroman "Ephraim
kehrt zur Luzerne zurück" des bedeutenden israelischen Autors S. Yizhar.
Laors Stück wurde von der israelischen Zensur verboten, "weil es die
Militärherrschaft in Judäa und Samaria herabsetzt". Schließlich wurde
das Stück jedoch vom obersten israelischen Berufungsgericht zur
Aufführung zugelassen.
1990 wurde er erneut von der Öffentlichkeit wahrgenommen,
weil Ministerpräsident Yitzhak Shamir sich weigerte, den Poesiepreis des
Ministerpräsidenten, der Laor verliehen werden sollte, zu unterzeichnen.
Laor gilt als sehr kritischer Dichter, sowohl hinsichtlich
seiner Themen als auch seiner Form und seines Stils. Der israelische
Kritiker Gabriel Levin schrieb, dass Baudelaires Bemerkung "Das Leben
ist ein Krankenhaus" das Motto der Gedichte in "A Night in a Foreign
Hotel" sein könnte, in denen Tod, Krankheit und Entfremdung wie eine
tief hängende Wolke über einer Wüstenlandschaft ununterbrochen anwesend
sind. Laor ist bekannt für seinen düsteren Blick auf die Menschheit.
Seine Beschreibungen, etwa vom Altern seiner Eltern oder des Todes einer
jungen Frau nach langer Krankheit, atmen eine große Intimität. Seine
Dichtung weckt Assoziationen mit Malerei und Film; seine Kraft ist
spürbar, auch wenn er Schmerz und Wut ausdrückt.
Leseprobe
hagalil.com
20-10-03 |