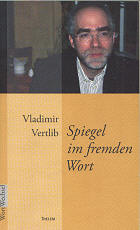
Vladimir Vertlib:
Spiegel im fremden Wort
Die Erfindung des Lebens als Literatur
Mit einem Nachwort von Annette Teufel und Walter Schmitz sowie einer
Bibliographie
Thelem Verlag 2007
Euro 14,80
Bestellen?
Leseproben:
"Ein deutsch schreibender jüdischer Russe,
der zur Zeit in Österreich lebt"
Literatur als Zwiegespräch:
"Hat Schreiben einen Sinn?"
|
Vladimir Vertlib:
Spiegel im fremden Wort
Von Andrea Livnat
Der vorliegende Band enthält jene fünf Vorlesungen, die Vladimir
Vertlib im Januar 2006 im Rahmen der Dresdner Chamisso-Poetikdozentur hielt.
"Die Erfindung des Lebens als Literatur", so der Untertitel, ist dabei der
rote Faden, der sich durch diese Vorlesungen zieht, die Vertlibs Thesen
jeweils durch Texte aus seinen Romanen und Essays verdeutlichen. Vertlib
erhielt im Jahre 2001 den Förderpreis zum
Adelbert-von-Chamisso-Preis, der deutschsprachige AutorInnen nicht
deutscher Muttersprache auszeichnet.
Thema der ersten Vorlesung, dem wir auch in den übrigen immer wieder
begegnen, ist dem vermeintlich "autobiographischen" Schreiben gewidmet.
Vladimir Vertlibs erste Erzählung "Abschiebung" von 1995, sowie sein erster
Roman "Zwischenstationen" von 1999 sind immer wieder als Autobiographien
missverstanden worden. Dennoch ist die Biographie des Autors eine Prämisse
seines Erzählens, woraus er selbstverständlich keinen Hehl macht: "Das
Wesentliche daran ist für mich, (...) ob bzw. wie sich die Mischung aus
Erlebtem, Hinzugedachtem und Assoziierten zu einem exemplarischen Fall
verdichtet und somit für den Leser zu einem Spiegel - auch einem Zerrspiegel
- der eigenen Gefühle, Erfahrungen, Ängste und Sehnsüchte wird."
Den Romanen und Erzählungen Vertlibs liegen jene Erfahrungen zugrunde,
die er selbst als Kind machen musste. 1966 in Leningrad geboren, machte
Vladimir Verlib die zahlreichen Stationen der Emigration seiner Eltern mit,
die 1971 die UdSSR verließen: "Israel - Österreich - Italien - Österreich -
Niederlande - wieder Israel - wieder Italien - wieder Österreich - USA - und
schließlich endgültig Österreich."
Vertlib stellt jedoch auch Fragen zur Authenzität einer tatsächlich
Autobiographie, die, so Vertlib, auch immer nur Fiktion sei, da das "eigene
Leben nachträglich neu "erfunden" wird". Für den Leser sei es egal, ob ein
Text einen autobiographischen Hintergrund habe.
Die zweite Vorlesung dreht sich um "Chancen, Möglichkeiten und Grenzen
von Literatur in einer Fremdsprache". Vladimir Vertlib beschreibt hier auch
seinen eigenen Weg von den ersten Schreibversuchen in Russisch hin zu einem
deutschsprachigen Schriftsteller.
Daneben widmet er sich allgemein jenen Frage, denen sich Menschen
gegenüber sehen, die eine Emigration durchmachen. Mehrsprachigkeit wird
dabei nicht nur als Gewinn, sondern auch als Reduktion und Verlust
beschrieben, "weil es - wenn man sich Sprachen als Kreise vorstellt - neben
einem Überlappungsbereich, in dem eine tatsächlich Sprachkompetenz in zwei
oder mehreren Sprachen besteht, immer Außenbereiche gibt, in denen man
monoglott oder fast monoglott bleibt."
Die dritte Vorlesung wendet sich dem Prozess des Schreibens von
"historischen Romanen" aus Emigrationserfahrung und Familienlegenden zu. Im
Mittelpunkt steht dabei Vertlibs Roman "Das besondere Gedächtnis der Rosa
Masur", der auf Aufnahmen basiert, die Vertlib von Gesprächen mit seiner
Großmutter machte und die schließlich 15 Jahre später als Vorlage für den
Roman dienten.
Unter der Überschrift "Der subversive Mut zur Naivität" geht Vertlib in
der vierten Vorlesung der Frage nach, ob Schreiben einen Sinn hat, und ob
Literatur Moral haben sollte. Eine Frage, die alle Schreibenden, wie auch
alle Künstler sich stellen und unterschiedlich beantworten. Für sich selbst
hat Vertlib eine eindeutige Antwort gefunden. Das Schreiben sei eben kein
Beruf wie jeder andere: "Die Gefahr einer solchen Haltung ist mir durchaus
bewusst: Je wichtiger man sich selbst nimmt, desto unwichtiger wird man mit
der Zeit, denn der Blick von oben streicht meist über die Köpfe der anderen
hinweg. Da ist es günstig, immer wieder auf den Boden der eigenen Ansprüche
und in den Keller der eigenen Eitelkeiten hinabzusteigen, um das Aufblicken
und das mühsame Emporsteigen neu zu erlernen."
Die letzte Vorlesung widmet sich unter der Überschrift "Ein deutsch
schreibender jüdischer Russe, der zur Zeit in Österreich lebt" der Rezeption
von Vertlibs Literatur. Für jeden Rezensenten wird es amüsant zu lesen sein,
was Vertlib hier feststellt, nämlich dass sich mit seiner Biographie und den
bisherigen Themen seiner Bücher, also Emigration, Krieg, Russland, wunderbar
ganze Rezensionen füllen lassen. Und so haben tatsächlich viele Rezensenten
mehr über den Autor als über seine Bücher geschrieben.
Vertlib ist nicht einfach in eine Schublade zu schieben, er ist in
Rezensionen bezeichnet worden als: "in Österreich lebender Russe", als
"russischer Schriftsteller", "in Deutschland lebender Israeli",
"jüdisch-deutscher Schriftsteller russischer Abstammung" etc.. Viele von den
geschilderten Vorurteilen oder Erwartungen an Vertlib als Jude, kann ich gut
nachvollziehen, wie mag das nur sein, wenn noch andere Aspekte von
"Identität" hinzukommen? Vertlib begegnet dem, wie im übrigen überhaupt, mit
einer angenehmen Prise von unaufdringlichem Humor, in der Vorlesung hat er
dies durch Ausschnitte aus seinem Roman "Letzter Wunsch" untermalt.
Vertlib ist niemals ein Schriftsteller, der das Trauma zur Schau trägt:
"Wer mag schon sein Leben lang unter einem Trauma leider, nur um ein gutes
Buch zu schreiben? Ich sicherlich nicht. Aber wenn ich es unter dem Eindruck
des Traumas schreiben kann, dann schreibe ich es. Anderenfalls hätte ich mir
für meine Bücher andere Themen gewählt. Schriftsteller wäre ich
wahrscheinlich auch dann geworden, wenn ich eine glückliche Kindheit gehabt
hätte."
Der Anhang enthält eine umfassende Bibliographie zu Vladimir Vertlibs
Publikationen, sowie eine Auflistung von Rezensionen und Sekundärliteratur.
Ein profundes Nachwort von Annette Teufel und Walter Schmitz bietet
schließlich eine Überblickseinführung in sein Werk und Schreiben, wobei im
Besonderen die Universalität der jüdischen Romanfiguren Vertlibs deutlich
wird, wie auch die Rolle der Literatur in der Gesellschaft: "Literatur -
nicht Geschichte oder Geschichtspolitik im engeren Sinn - ist jene Instanz,
die das Gedächtnis der Zeit bewahrt."
Wer Vladimir Vertlibs Romane und Erzählungen noch nicht kennt, wird nach
der Lektüre seiner Vorlesungen mehr lesen wollen. Und wer bereits etwas von
Vertlib gelesen hat, wird den Blick hinter die Kulissen genießen. Allen wird
dieses wundervolle Buch aber vor allem eines machen: Lust auf Literatur.
hagalil.com
06-11-07 |