|
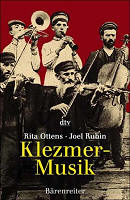
Rita Ottens, Joel Rubin:
Klezmer-Musik
Dtv 1999
Euro 10,00
Bestellen?
Mehr von Rita Ottens und Joel Rubin:
Klezmer-Musik
"Fassade des Stimmigen":
Jüdische Musik in Deutschland
http://www.
rubin-ottens.
com
"The Sounds of the
Vanishing World": The German Klezmer Movement as a Racial Discourse
Download: PDF (840K)
(A shorter version of this article was originally
presented at the conference, “Sounds of Two Worlds: Music as a Mirror of
Migration to and from Germany,” in September 2002 at the Max Kade
Institute for German-American Studies at the University of Wisconsin in
Madison. See also:
Rita Ottens with Joel E. Rubin
Web Based Conference Proceedings University of Wisconsin, Madison Max Kade
Institute for German-American Studies, 2004) |
Klezmer-Musik:
Das Geheimnis der jüdischen Geige
Von Rita Ottens und Joel Rubin
Aus dem Buch "Klezmer-Musik", S.
107-109
"Ihr wollt wissen, wieviele Männer unter einem Dach
wohnen? Schau an die Wände! Es wohnen so viele Männer dort, wie Geigen
daran hängen!" schrieb Isaac Lejbusch Peretz in seiner klassischen
Erzählung "A Gilgl fun a Nign" (Die Seelenwanderung einer Melodie,
1901).
Es ist nicht das erste Mal, daß nach den Ursachen des
großen Anteils jüdischer Musiker, insbesondere unter den bedeutendsten
Violinsolisten seit der Zeit um die Jahrhundertwende, gefragt wird. Der
Publizist Joachim Harnack spricht von den "gewissen Eigenarten ihres
Spiels", das insbesondere durch "eine besonders satte Färbung – und zwar
ein dunkel-sonores Timbre" des Tons – charakterisiert ist. Hartnack
bemerkt einen einerseits "eigenartigen sinnlichen Schimmer" bei Geigern
wie Huberman, Elman und Heifetz und zeigt sich andererseits erstaunt
über den "keuschen" Ton von Menuhin oder über Milsteins "beinahe kühle
Noblesse, aus der jeder Hauch von Sinnlichkeit verbannt scheint – um
dann bei anderer Gelegenheit um so deutlicher hervorzutreten".
Was ist nun das Geheimnis dieses besonderen Tons, an dem
sich noch bis zur Jahrhundertmitte die jüdische Herkunft eines Geigers
nachweisen ließ? Hartnack vergleicht bewundernd die "besondere Glätte
der Tonemission und eine ganz eigene Art des Portamentospiels" jüdischer
Geiger auf Schallplatten der dreißiger Jahre mit dem Portamentosingen
des Kantoren Joseph Schmidt (1904–1942) aus Davideni/Bukowina und
erkennt Ähnlichkeiten zwischen Gesangstechnik der Kantoren und den
"Tonmodulationen und der Tonbewegung" von Jascha Heifetz – "und zwar
nicht nur im Legato, sondern auch beim Détaché." Hier jedoch fehlt
Hartnack das letzte Stück im Puzzle, die Kenntnis über Klezmorim – von
der Musikgeschichtsschreibung bis heute zumeist als Folklore abgetan und
daher als nicht zur Hochkultur gehörig erachtet.
Hätte er jemals die Aufnahmen der Geiger Winjar oder
Zehngut [Die unmittelbar nach Drucklegung des Buches neuesten
diskografischen Forschungsergebnisse wurden von uns bereits im Booklet
zur CD "Oytsres" eingearbeitet. Danach war Winjar der Name einer
Sängerin des Jiddischen Theaters Kiew, die bei den
Rabinowitsch-Einspielungen 1937 mitwirkte. Siehe auch Prolog "Ein
Klezmer-Orchester für Väterchen Stalin, S. 19-39. Richtig muß es also
heißen "die Geiger Rabinowitsch und Zehngut". Die Autoren] oder gar den
Klarinettisten Dave Tarras mit seiner Raffinesse hören können, hätte er
leicht zu dem Schluß gelangen können, daß das Geheimnis der großen
jüdischen Geiger in der eng mit dem Synagogalgesang verwobenen Tradition
der Klezmorim liegt, von der auch Joseph Schmidts Vortrag geprägt war.
Dabei enthält eine der frühen Joseph Schmidt-Biographien
noch eine erstaunlich detaillierte Beschreibung der musikalischen Welt
des Sängers, der "in seinen größten Momenten mit einer todberührten
Inbrunst" sang, so der Kritiker Jürgen Kesting. Die Einflüsse der
Volkslieder, "Doinas", "Horas", Gassenhauer und Musik der Zigeuner auf
den angehenden Weltstar fehlen in späteren Lebensbeschreibungen
gänzlich, übergangen werden auch die als Klezmorim nicht ausdrücklich
gekennzeichneten "jüdischen Musikkapellen mit ihrer Originalität und
ganz eigenem Stil". Ebenso unbefriedigend wie aufschlußreich ist die
musiklexikalische Behandlung der Klezmorim und ihrer Musik: Sie
erscheinen allenfalls als wenig beachtenswerte Anhängsel der Liturgie
und nicht als lebendige Bewahrer "eines bis in die Frühzeit
zurückreichenden künstlerischen Erbes, das die Kunstmusiker zumeist
verachtend abstreiften", wie es der Musikwissenschaftler Walter Salmen
für die Spielleute formulierte. Auch der Klezmer gab neben der "musica
composita" seiner Zeit die Traditionen der nicht komponierten Musik aus
der Frühzeit in schöpferischen und vielfältigen Umformungsprozessen an
die nächste Generation weiter.
Grundsätzliches zu Mißverständnissen der
Klezmer-Musik
Nur so ist auch zu verstehen, warum in den Biographien
der großen Geigenvirtuosen deren Väter mißverständlicherweise als
"Amateurgeiger" wie bei Joseph Achron oder unter der Berufsbezeichnung
"Dorfschullehrer" – so Mischa Elmans Vater – erscheinen. Auch Heifetz'
Vater Reuven stammte aus dem Klezmer-Milieu: Er sei "Theatermusiker"
gewesen, wobei die Frage offenbleibt, ob allgemeines oder Jiddisches
Theater, vermutlich spielte er außerdem auch auf Hochzeiten. Seine
Stellung als Konzertmeister beim Symphonieorchester in Wilna verdankte
er seiner Ausbildung als Klezmer und als Musiker in einem jiddischen
Theaterorchester, was durchaus nicht – wie vielfach angenommen – immer
dasselbe ist.
Der Begriff eines "Amateurmusikers" besaß im jüdischen
Osteuropa eine ganz andere Bedeutung als in Westeuropa, das seine
Kriterien auf einen Beruf und eine Musik anwendet, für deren Spielweisen
sich eigene Ausbildungsstrukturen heranbildeten und die deshalb auch
eine systematische Konservatoriumsausbildung nicht erforderlich machten
– ohnehin war Juden der Besuch der Konservatorien nicht vor dem letzten
Viertel des 19. Jahrhunderts möglich. Wie wichtig für das Verständnis
der Klezmer-Musik und ihrer Weiterentwicklung gerade die Kenntnis der
gesellschaftlich-religiösen Strukturen des jüdischen Osteuropas ist,
verdeutlichen folgende Details: Die Bezeichnung "Dorfschullehrer" für
Elmans Vater, dessen Vater wiederum ein bekannter Klezmer in Uman war,
verkennt zum einen die Tatsache, daß Talnoje mit seinen 10 000
Einwohnern – davon mehr als die Hälfte Juden – keineswegs ein Dorf war,
sondern immerhin Sitz des chassidischen Hofes von Reb Dowidl Twersky mit
seinem berühmten Chasn Reb Jossele Tolner.
Zum andern konnte Elmans Vater Saul neben seiner
Stellung als "Melamed", als Lehrer in einem Chejder, offensichtlich auch
als ein nach dem Klezmer-System vollendet ausgebildeter Geiger und
Pädagoge gelten. Denn bis zu seinem zwölften Lebensjahr erhielt Mischa
Elman Violinunterricht von seinem Vater, erst nach seinem gefeierten
Berliner Konzertdebüt im Jahre 1904 setzte der frühvollendete Künstler
seine Studien bei Alexander Fiedelman an der Kaiserlichen Musikschule in
Odessa fort.
Das Unterrichtssystem des "Chejder" vermittelte den
jüdischen Knaben eine klassische Ausbildung. Das Lesen der hebräischen
Schriften versetzte sie in die früheste Zeit ihres Volkes zurück und
erzeugte auf diese Weise ein beständiges Nebeneinander von Gegenwart und
Vergangenheit im Denken bereits der jüngsten Schüler. So unterrichtete
ein Melamed neben dem biblischen Hebräisch noch ein halbes Dutzend
hebräische und aramäische Dialekte, von der Sprache der "Mischna", der
um 200 u. Z. redigierten Grundlage des Talmud, bis zu der rabbinischen
Sprache des Kommentators Raschi aus dem 11. Jahrhundert. Im Chejder
wurde auf die hebräischen Fächer tatsächlich drei- bis viermal soviel
Zeit verwandt wie in den besten Gymnasien Europas auf Latein und
Griechisch zusammen.
Wie fruchtbar sich gerade dieses kompromißlose
Eintauchen in die geschichtliche Vergangenheit auf die jüdische Kultur
auswirkte, beweist nicht nur die enge Verflechtung von Talmud und Tora
mit der liturgischen und der klezmerischen Festmusik: Das über tausend
Jahre entwickelte Lehr- und Denksystem auf der Grundlage dieses
religiösen Schrifttums bildete auch den geistigen Nährboden für die
Elite der klassischen Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts und so
unterschiedlicher Vertreter der künstlerischen Moderne wie die Maler
Marc Chagall und Chaim Soutine (1893–1943) sowie die avantgardistische
Bewegung der "Insichisten", der Introspektivisten, einer Gruppe um die
jiddischen Dichter Jacob Glatshteyn (1896–1971) und A. Leyeles (Aron
Glanz; 1889–1966) im New York der zwanziger Jahre.
Aus dem Buch "Klezmer-Musik", Rita Ottens und Joel
Rubin, S. 107-109.
© Rita Ottens and Joel Rubin 1999
http://www.rubin-ottens.com
hagalil.com
04-10-04 |