|
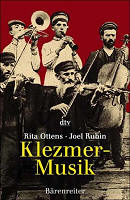
Rita Ottens, Joel Rubin:
Klezmer-Musik
Dtv 1999
Euro 10,00
Bestellen?
Mehr von Rita Ottens und Joel Rubin:
Das Geheimnis der jüdischen Geige
"Fassade des Stimmigen":
Jüdische Musik in Deutschland
Im Zentrum eines alten
Rituals - Die Klarinette in der Klezmer-Musik
http://www.
rubin-ottens.
com
"The Sounds of the Vanishing World": The
German Klezmer Movement as a Racial Discourse
Download: PDF (840K)
(A shorter version of this article was originally
presented at the conference, “Sounds of Two Worlds: Music as a Mirror of
Migration to and from Germany,” in September 2002 at the Max Kade
Institute for German-American Studies at the University of Wisconsin in
Madison. See also:
Rita Ottens with Joel E. Rubin
Web Based Conference Proceedings University of Wisconsin, Madison Max Kade
Institute for German-American Studies, 2004)
|
Lesetipp zu einem In-Phänomen:
Klezmer-Musik
Von Rita Ottens und Joel Rubin
Aus dem Vorwort zum Buch "Klezmer-Musik", S. 9-13
In den zwanziger Jahren wurde die als große
musikalische Sensation gefeierte "Yiddish American Jazz Band" des
Klezmers Joseph Cherniavsky von einer amerikanisch-jiddischen Zeitung
als "möglicherweise der erste erfolgreiche Versuch, jiddische Musik
wiederzubeleben" gewürdigt.
Um dieselbe Zeit inszenierte am Jiddischen Theater in
Moskau der Reinhardt-Adept Alexander Granowski das Stück "Nachts auf dem
alten Markt" von Isaac Lejbusch Peretz als schrillen Bilderbogen über
eine verschwindende Tradition und sterbende Kultur: Der Marktplatz
erschien als ein Friedhof. Und während die großen Klezmer-Klarinettisten
Naftule Brandwein und Dave Tarras das heimwehkranke osteuropäische
Immigrantenpublikum der Lower East Side mit ihren Klängen beglückten,
erhoben die jiddischen Dichter des New Yorker "Insichisten"-Kreises ihre
Stimmen zu einem letzten großen Lamento: Mit einer nie gekannten
Bitterkeit klagten die von Joyce und Kafka beeinflußten
introspektivistischen Sprachvirtuosen, Zeitgenossen der Klezmer-Kultur
und des jiddischen Operettentheaters der Second Avenue, über ihre
Isolation und Ghettoisierung als jiddische Dichter-Avantgarde und
Intellektuelle. Ihre Kunst wurde weder von den ungebildeten
Immigrantenkreisen noch von den nichtjüdischen Intellektuellen- und
Künstlerzirkeln wahrgenommen.
"Seit mindestens 150 Jahren 'verschwinden' Juden als
folkloristische Objekte", bemerkt lakonisch die amerikanische
Folkloristin Barbara Kirshenblatt-Gimblett, und die in den letzten
Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts einsetzenden Aktivitäten
jüdischer Forscher und Musiker zur Bewahrung jiddischer Musik lassen
bereits ein ausgeprägtes Bewußtsein für die allmählich stattfindende
Auflösung der traditionellen Lebensformen erkennen. Mit dem Fall des
Eisernen Vorhanges und der Neuordnung Europas vollzieht sich die
Historisierung der Shoah in einer gleichzeitigen Welle von Bewahrungs-
und Weiterentwicklungsbestrebungen jiddischer Kultur und Musik gänzlich
neuer Art: "Klezmer Chai", Klezmer lebt, so nannte sich vor einigen
Jahren eine Klezmer-Band aus Leverkusen, und eine ebenfalls
nichtjüdische Krakauer Klezmer-Band wirbt gar mit kabbalistischer
Symbolik auf dem Cover für ihren Anspruch, "etwas Neues und in der
jüdischen Musik Einzigartiges zu schaffen."
Während sich Barbara Kirshenblatt-Gimblett gegen die
weitverbreitete Haltung ausspricht, jüdische Ethnographie ausschließlich
im Lichte der Shoah zu sehen, ist Klezmer, der traditionellen Hochzeits-
und Festmusik des osteuropäischen Judentums in Europa genau das
beschieden: Dazu ausersehen, das jüdische Vakuum in Europa auszufüllen,
das die Shoah hinterlassen hat, beginnt sie als Symbol für das Judentum
eine Rolle in der populären Kultur zu spielen, wobei ihr ein
verdächtiges Übermaß an Wohlwollen und Bewahrungsbekundungen seitens des
Publikums und der Medien zuteil wird – was könnte einer Musik
Schlimmeres passieren!
Die vorliegende Geschichte der Klezmer-Musik handelt
nicht vom Klezmer-Revival in Amerika und seinen Ausläufern in Europa,
sondern von der eigentlichen Klezmer-Musik und der Klezmer-Kultur, wie
sie in Osteuropa als Lebensform innerhalb einer vom jüdischen
Religionsgesetz bestimmten Gemeinschaft bestand. Entstanden ist so die
kollektive Biographie der Klezmer-Musiker Osteuropas und ihrer
unmittelbaren Nachfahren, geschrieben aus der Perspektive der
traditionellen jiddischsprachigen Klezmorim selbst. Die jüngsten
Interviewpartner waren siebzig Jahre alt, Angehörige einer spärlich
dokumentierten funktional-rituellen Musikkultur, die – außer in den
chassidischen Gemeinden Israels – heute nicht mehr existiert. So starb
der Trompeter Willie Epstein im Juli 1999 im Alter von achtzig Jahren in
Florida während der letzten Korrekturen am Manuskript unseres Buches;
sein Bruder Max, heute der einzige lebende Klezmer-Musiker von Rang,
dessen Spiel und Repertoire noch von osteuropäischen Einwanderermusikern
geprägt war, erlitt vor drei Jahren einen Schlaganfall, kurz nach
Beendigung des auf unseren Forschungen und Interviews basierenden
Dokumentarfilms über ihn und seine Brüder, "A Tickle in The Heart."
Wie in der Geschichtsschreibung üblich, haben wir aus
den Erinnerungsfragmenten, nicht selten einander widersprechend, und der
Materialfülle die Beispiele ausgewählt, die uns besonders typisch oder
bedeutsam erschienen. Bewußt wurden Begriffe aus der jiddischen und
hebräischen Sprache, dem Umfeld der Klezmer-Musik, beibehalten, um die
Musik mit der ihr eigenen Terminologie zu beschreiben und die sozialen
und kulturellen Zusammenhänge der "Klezmeraj", ihr Ausbildungssystem und
ihre Aufführungspraxis sowie den musikalischen Formenreichtum der
osteuropäisch-jüdischen Welt angemessen zu vermitteln (ein Glossar und
Hinweise zur Aussprache dieser Bezeichnungen finden sich im Anhang).
Im vorliegenden Buch werden zum ersten Mal die Wurzeln
der Klezmer-Musik im religiösen jüdischen Schrifttum freigelegt, ihre
ursprünglich magischen Funktionen und ihr Sitz im mittelalterlichen
Volksglauben der rheinländischen Juden dargestellt. Überraschend mag
auch die von den Klezmer-Virtuosen des 19. Jahrhunderts wie Gusikow und
Pedotser bis hin zu Dave Tarras und Max Epstein vollzogene Hinwendung
der jiddischen Instrumentalisten zur westeuropäischen Kunstmusik
erscheinen, verbindet man doch zumeist Urwüchsigkeit, Leidenschaft und
Sentimentalität mit der bunten, schrägen, anarchischen Musik aus
jiddischen, Jazz und Rock-Elementen, die der World Music-Markt heute als
"Klezmer" für die sinnsuchende Gesellschaft bereitstellt.
Musikalisch kann Klezmer-Musik nicht als isoliertes
Phänomen betrachtet werden: Eine Darstellung ohne die Einbeziehung der
Wechselwirkung mit traditionellen südosteuropäischen Musikkulturen ist
ebensowenig möglich wie die Ausklammerung ihrer Funktionen in der
jüdischen Religionsausübung, die sie – zusammen mit chassidischer und
synagogaler Musik – seit Jahrhunderten bewahrt. Das säkulare Yiddish und
Klezmer-Revival Amerikas, das gerade diesen Religionsbezug nicht zur
Kenntnis nehmen will, basiert auf einer gänzlich anderen Entwicklung:
Auf der Nahtstelle zwischen der Alten und Neuen Welt entstand eine
Unterhaltungskultur der jiddischsprachigen Immigranten-Unterschichten
der Lower East Side, deren Nachkommen in das amerikanische
Mainstream-Entertainment, den Jazz und in die klassische Musik
abwanderten.
Die amerikanischen Revivalisten übernahmen die aus
wenigen Elementen der osteuropäischen Spielweisen bestehende
kommerzielle jiddische popular- und Klezmermusik und nahmen eine
künstliche Archaisierung vor, die mittlerweile zu einem primitiven
Einheitsstil geführt hat, der das genaue Gegenteil zu dem an Paganini
orientierten Ideal der Schtetl-Klezmorim darstellt. So schließt das Buch
mit einem kritischen Überblick zum Klezmer- Und Yiddish-Revival, das
diese Musik seit über zwanzig Jahren popularisiert, aber eben nur
scheinbar eine echte Fortsetzung der jahrhundertealten Tradition
darstellt. Es fehlt die Basis der jiddischen oder hebräischen Sprache,
der chassidischen oder liturgischen Musik, der jüdischen Religion und
nicht selten die Kenntnis der mittlerweile historischen Entwicklung des
Yiddish-Revivals selbst. Aber gerade die gegenwärtige Situation in den
streng orthodoxen Gemeinden Israels zeigt, daß sich die
Klezmer-Tradition im religiösen Umfeld erhalten und weiterentwickeln
konnte, wenn auch in Formen, die mit ästhetischen Maßstäben allein nicht
zu fassen sind, weil sie allein auf religiösen Funktionen fußen.
Gerade dies ist das Anliegen des Buches: die
Klezmer-Musik in ihrer Eigenart zu definieren und ihren Weg von der
funktionalen Einbettung in das jüdische Ritual bis zur ästhetisierten
und kommerzialisierten Form zu beschreiben. Denn losgelöst von der
jüdischen Religion erscheint Klezmer-Musik nur als ein Sammelsurium von
willkürlichen Tönen und Rhythmen. Begriffsunschärfen und Unkenntnis
haben zu Beliebigkeit, Austauschbarkeit und Putzigkeit mit
"Klezmer-Tangos", "Klezmer-Chansons", "Klezmer-Tänzen" geführt — und das
entspricht nicht der geschichtlichen Wahrheit der einst hochentwickelten
urbanen jüdischen Festmusik Osteuropas, aus deren Reihen die Elite der
klassischen Virtuosen des 20. Jahrhunderts von Mischa Elman bis Emanuel
Feuerman hervorging.
Nur mit einem fachübergreifenden Ansatz, der Elemente
aus Musikethnologie und historischer Musikologie, Judaistik,
vergleichender Religions- und Literaturwissenschaft, Geschichte,
Soziologie sowie Cultural Studies vereint, war es uns möglich, die
komplexen Entwicklungen der traditionellen Klezmer-Musik zu erschließen
und ihren Weg über Zeitalter und Kontinente darzustellen. Seit 1989
führen wir Interviews und Forschungen in den USA, Ost- und Westeuropa
(u. a. Litauen, Rußland und Birobidschhan) sowie Israel durch, dazu
kommt eine Sammeltätigkeit seit den 60er Jahren. Die musikalische
Zusammenarbeit von Joel Rubin – selbst einer der ersten Protagonisten
des Revivals in den USA – insbesondere mit den Epstein Brothers und den
chassidischen Musikern in Israel öffneten uns die Türen zu einer Welt,
deren Denken und Fühlen nicht nur unsere Forschung bereichert und dieses
Buch möglich gemacht hat, sondern auch unser Leben insgesamt veränderte.
Die parallel produzierte CD "Oytsres (Treasures):
Klezmer Music 1908–1996" (Wergo) entspricht in der Auswahl unserer
derzeitigen Auffassung und der Intention des Buches. Möge dieses Buch
dazu beitragen, was die "Insichisten" für ihre Literatur vergeblich
einforderten: Daß die jiddische Kultur und die Klezmer-Musik nicht mehr
unbekannt bleibe und ihre Künstler nicht mehr als "Hottentotten"
betrachtet werden – nicht nur im Hinblick auf die phänomenologischen,
sondern durchaus auch im Hinblick auf die gesellschaftlichen
Implikationen.
Aus dem Vorwort zum Buch "Klezmer-Musik", Rita Ottens
und Joel Rubin, S. 9-13.
© Rita Ottens and Joel Rubin 1999
http://www.rubin-ottens.com
hagalil.com
04-10-04 |