
Gisela Dachs (Hrsg.):
Jüdischer Almanach, Kindheit
Jüdischer Verlag bei
Suhrkamp 2003
Euro 14,80
Bestellen?

Jüdischer Almanach 2003:
Vom Essen
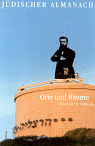
Jüdischer Almanach 2002:
Orte
und Räume |
"Die Kindheit ist unsere Heimat":
Jüdischer Almanach über die Kindheit
Von Andrea Livnat
Der aktuelle jüdische Almanach dreht sich um das Thema
"Kindheit", es geht um Eltern und deren Erwartungen,
Kindheitserfahrungen verschiedener Zeiten, um das Großwerden in Europa,
Bagdad, Tel Aviv, im Ghetto.
Die Herausgeberin Gisela Dachs weist im Vorwort darauf hin,
dass es schon einmal einen Jüdischen Almanach gab, der sich mit
"Kindheit" beschäftigte, 1937. Der Band erschien damals in Prag, in
einer "von Beklommenheit und Zukunftsangst geprägten Atmosphäre". Felix
Weltsch schrieb in seinem Geleitwort, warum gerade dieses Thema
besonders wichtig erschien: "Weil dies der natürlichste und wahrhafteste
Trost ist, denn das Leben uns bietet." Auch wenn das jüdische Kind nicht
nur Trost sei, denn es sei auch ein Problem. "Alle Fragen unseres
Erwachsenen-Lebens spiegeln sich nämlich in zarter, aber nicht weniger
ernsten Form im Leben des jüdischen Kindes wider."
Auch im Almanach für 2004 spiegeln sich die Freuden, Ängste
und Sorgen der Erwachsenen in der jüdischen Kindheit wider. Immer wieder
drehen sich die Beiträge um Heimat, Entwurzeltsein, Umzug und Neuanfang,
am eindrucksvollsten thematisiert bei Robert Schopflochers
"Kindheitsheimat". Er schreibt von der "inneren Heimat", die man immer
mit sich herumträgt, eine Erfahrung, die alle Ausgewanderten irgendwann
machen. In Schopflochers Fall, der Schriftsteller lebt seit 1937 in
Buenos Aires, ist diese Heimat Fürth, die Erinnerungen an Geruch und
Geschmack der fränkischen Küche, die Mutter im Dirndlkleid, Karl May und
Spaziergänge mit dem Vater wach halten, "latente, stets abrufbare
Erinnerungsfetzen". Adin Talbar berichtet von seiner Schulzeit in einem
"zionistischen Biotop", an der Theodor-Herzl-Schule in Berlin. Von einer
Kindheit in Österreich handelt Avi Raths Beitrag über sein
"Bar-Mizwa-Fahrrad".
Zohar Shavit gibt einen Überblick, was jüdische Kinder im
Dritten Reich lasen. Im Anschluss daran findet der Leser einen Aufsatz
von Ivan Polak, der als 14-Jähriger in Theresienstadt unter dem
Pseudonym "Zgebanina" die Zeitschrift Kamarad herausgab. Ivan wurde von
Theresienstadt aus im Oktober 1944 nach Birkenau deportiert. Von dort
kam er in das Dachauer Außenlager Kaufering, wo er im Alter von fünfzehn
Jahren am 19. Januat 1945 umkam. Seiner Zeitschrift Kamarad ist derzeit
eine Ausstellung in der israelischen Gedenkstätte
Beit Terezin gewidmet, in der alle zweiundzwanzig Originale zu
sehen sind.
Der israelische Schriftsteller Sami Michael berichtet von
seiner Kindheit in Bagdad und den schmerzlichen Erfahrungen, die er in
einem traditionellen "Cheder" sammeln musste. Die israelische
Perspektive wird durch den Beitrag von Michael Dak eingeleitet, der als
israelisches Diplomatenkind immer wieder seine Heimat verlassen musste.
David Tartakover gibt Einblick in israelische Kinderspiele und den
Pionier der Spielzeugfertigung in Erez Israel, Benjamin Barlevi.
Von einer besonderen Freundschaft handelt Sylke Tempels
Beitrag, ein Auszug aus dem Buch "Wir
wollen beide hier leben". Von Mitte August bis November 2002
tauschten sich die muslimische Palästinenserin Amal und die jüdische
Israelin Odelia, beide 18 Jahre alt, in Briefen über ihr Leben, ihren
Alltag, ihre Zukunftswünsche aus. Amal schreibt, sie würde lieber an die
Zukunft als an die Vergangenheit denken, "und daran, was ich mit meinem
Leben anfangen werde. Aber da dieser Krieg anhält, kann ich die
Vergangenheit einfach nicht vergessen". Odelia hatte ihr zuvor
geschrieben, dass sie beide in Jerusalem zu Hause seien, auch sie wurde,
wie Amal, erst vor 18 Jahren dort geboren. "Das hier ist meine Heimat.
Was kann ich da machen? Und deshalb müssen wir lernen, miteinander zu
leben. Auch wenn das wie eine Platitüde klingt. Ich liebe diese Stadt,
mögen mich die Europäer deswegen ruhig für verrückt halten. Aber sie ist
unser Zuhause."
hagalil.com
02-01-04 |