|
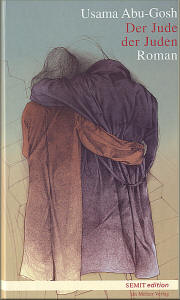 Presseinformation Presseinformation
Usama Abu-Gosh:
Der Jude der Juden
Sami, der eigentlich Usama heißt und Araber ist, aber
vorgibt, zu der jüdischen Bevölkerung Israels zu gehören, lebt in der
ständigen Angst davor, entdeckt zu werden.
Damit niemand seine wahre Identität erfahrt, geht er keine festen Bindungen
ein. Bis zu dem Tag, als er die Jüdin Racheli kennen lernt: Trotz aller
Hindernisse entwickelt sich zwischen beiden eine langjährige und
leidenschaftliche Liebesbeziehung, die allerdings ständig auf die Probe
gestellt wird. Und eigentlich weiß Sami, dass die Tatsache, dass Racheli
Jüdin und er Araber ist, einem Zusammenleben keine Chance lassen.
Der Jude der Juden handelt von Liebe und Hass, Hoffnung und Enttäuschung und
dem Rassismus innerhalb einer jüdischen Gesellschaft, die selber Opfer des
Rassismus gewesen ist.
Aus dem Inhalt:
... "Racheli sah mich an und ich ertrank in ihren Augen. Ich hatte das
Gefühl, dass sie sich darüber freute, dass das verborgene Geheimnis
aufgedeckt war, und sich sogar über das verbotene Spiel amüsierte. Dann fing
sie an zu lachen: „Fallschirmspringer, eh? Ein Held! Bist du immer noch
sicher, dass du keine Gebiete zurückgeben willst?" Jetzt war es mir schon
gleichgültig, dass sie über meine unmögliche Vortäuschung eines jungen Juden
spottete. Hauptsache, dass ich ab jetzt von dem Lügengespinst befreit war,
in das ich mich verstrickt hatte. Endlich konnte ich wieder ich selbst sein,
musste kein doppeltes Spiel mehr spielen"...
...weitere
Leseproben
»Ein Roman, der das spannende Leben eines
arabischen Israeli erzählt, der sein Leben lang im Dickicht der Beziehungen
zwischen der arabischen Minderheit und der jüdischen Mehrheit in Israel
verbracht hat. Es schildert den täglichen Rassismus der israelischen
Gesellschaft.«
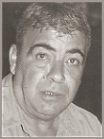 Der
Autor: Der
Autor:
Usama Abu-Gosh ist ein arabischer Israeli, der 1948 mit seiner Familie aus
dem Geburtsort Jaffa vertrieben wurde und dennoch in einer anderen Stadt
innerhalb Israels geblieben und aufgewachsen ist. Er lebt heute mit seiner
Frau und seinen Kindern in Lod, einer gemischt jüdisch-arabischen Stadt in
der Nähe von Tel Aviv.
Melzer Verlag,
Neu-Isenburg 2004, SEMIT edition, 260 Seiten, Hardcover,
ISBN 3-937389-31-8, 24,95 €/41,95 sFr
[BESTELLEN?]
pp92 ff...
... Eines Tages erzählte Racheli begeistert, sie habe neue Tapeten für die
Küche gekauft, und im Geschäft habe man ihr erklärt, wie man sie selbst
ankleben könne. Ich versprach ihr, am Wochenende dabei zu helfen. Schon bald
merkte ich, dass das schwieriger war, als ich gedacht hatte. Beim Kleben
grübelte ich darüber nach, wieso ich etwas, von dem ich nichts verstehe, auf
mich genommen hatte. Doch dann merkte ich je weiter ich voran kam, dass
diese Arbeit recht gut zu mir passte. Als schließlich die Küche erfolgreich
verschönert war, bat ich Racheli, auch für das Wohnzimmer Tapeten zu kaufen.
Racheli, die mir bei der Arbeit zugeschaut und gemerkt hatte, dass ich
manchmal nervös wurde, wunderte sich über meinen Vorschlag. Sie hätte
gedacht, ich würde nie wieder Tapeten kleben wollen. Nach einiger Zeit
brachte sie die Tapeten für das Wohnzimmer und die klebte ich bereits wie
ein Meister.
Diese Arbeit passte wirklich zu mir und ich machte einen Beruf daraus. Nach
einiger Zeit hatte ich genug Erfahrung und nahm meinen kleinen Bruder zu
mir, anfangs als Gehilfen, doch nachdem auch er das Fach gelernt hatte,
arbeitete er auch selbständig. Bei dieser Arbeit hatte ich keine
Vorgesetzten, und es gefiel mir, nach getaner Arbeit die alten Wände wie neu
zu hinterlassen. An Arbeit hat es uns nicht gefehlt — mein Bruder und ich
hatten einen guten Ruf bei den Tapetenhändlern, die uns ihren Kunden
empfahlen.
Auch bei dieser Arbeit fehlte es nicht an Zwischenfällen, die mir immer
wieder die Stimmung verdarben. Eines Tages, als wir in einer Tel Aviver
Wohnung gerade bei der Arbeit waren, kam der Tapetenhändler, der uns seinem
Kunden empfohlen hatte und verlangte von uns, die Arbeit einzustellen. Ich
wusste nicht, um was es ging, bis er schließlich damit herausrückte und
schimpfte: »Was redet ihr auch arabisch miteinander? Die Kundin will nicht,
dass Araber in ihrer Wohnung arbeiten. Dass jeder Kunde seine Meinung hat,
solltet ihr eigentlich wissen. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann
nicht dafür, dass ihr jetzt gehen müsst. Ich muss jetzt selber eure Arbeit
zu Ende machen. Wenn ihr das nächste Mal bei Juden arbeitet, redet kein
Arabisch, dann braucht auch keiner zu wissen, dass ihr Araber seid!«
Abgesehen von Vorkommnissen dieser Art, die meisten mit einem nationalen
Beigeschmack, dachte ich, dass mein Leben nun in einer sicheren Bahn
verliefe. Ich hatte eine Frau, die ich liebte, eine Arbeit, die mir gefiel
und Freude machte und bei der ich auch gut verdiente. Im Inneren aber war
ich überzeugt, dass das alles nur Selbstbetrug war und nur nach außen hin
diesen Eindruck erweckte. Nicht nur einmal schlug die Wirklichkeit mir ins
Gesicht. Als es beispielsweise Racheli seltsam erschien, dass ich mich
weigerte, einer Nachbarin die Wohnung zu tapezieren. Ich weigerte mich
natürlich nur, weil ich vermeiden wollte, von der Nachbarin als Araber
erkannt zu werden. Die schweren Fragen über die Zukunft unserer Beziehung
versuchte ich hinauszuschieben. Drei Jahre lebten wir zusammen, und gaben
uns Mühe, Themen, die Spannungen zwischen uns heraufbeschwören könnten, zu
vermeiden. Wir versuchten so gut es ging, in unserer kleinen Welt unser
Leben zu meistern. Tagtäglich genossen wir nach der Arbeit die Wärme in
unserer gemütlichen Nische.
Bis zu diesem Sabbat, der mit dem Jom-Kippur-Fest, dem Versöhnungstag
zusammenfiel. Ich weiß nicht mehr, weswegen wir gerade an diesem Tag Ärger
miteinander hatten und nicht miteinander sprachen. Als aber Racheli Kaffee
für sich kochte, brachte sie mir auch eine Tasse. Mir war langweilig und ich
fühlte mich wie ein Löwe, der gegen seinen Willen eingesperrt ist. An Jom
Kippur herrscht in Israel absolute Stille: kein Radio, kein Fernsehen, keine
Verkehrsmittel.
Aus Sorge, dass einer der Nachbarn es eventuell hören könnte, gestattete
Racheli mir nicht einmal, einen arabischen Sender im Radio zu hören. Am
frühen Nachmittag zerriss dann plötzlich das Heulen von Sirenen die absolute
Stille. Die an- und abschwellenden Töne fuhren uns in die Glieder. Racheli
schaute aus dem Fenster und sah einen regen Autoverkehr auf der Straße.
Nervös sagte sie: »Da geht etwas vor, stell mal das Radio an!« Im Radio
hörten wir Marschmusik. An Jom Kippur. Das war schon mehr als merkwürdig,
das war beängstigend.
Später, als Nachrichten durchgegeben wurden, und der Aufruf an die
Reservisten, sich bei ihren Einheiten zu melden, wurde uns wie allen anderen
klar, dass wieder einmal ein Krieg ausgebrochen war. Erregt und deprimiert
saßen wir da und schauten einander an. Wir hatten so etwas nicht erwartet.
Ich konnte nicht glauben, dass Ägypten und Syrien einen Krieg beginnen
würden. Meine Erfahrung mit dem Sechstagekrieg war, dass Israel zwar
meldete, es sei angegriffen worden und müsse sich verteidigen, dass es sich
tatsächlich aber gerade umgekehrt verhielt. Ich schlug vor, die Nachrichten
von den arabischen Sendern zu hören. Im jordanischen Sender hörten wir
nichts über einen Krieg, nur Musik, wie gewöhnlich. Auch über den
ägyptischen Sender hörten wir zunächst nichts von einem Krieg, doch später
meldete der Sprecher in einem arrogant herausfordernden Ton, die ägyptische
Armee würde im Sinai den flüchtenden israelischen Soldaten nachjagen.
»Ich glaube, dass man diesmal mit euch das macht, was ihr im Sechstagekrieg
gemacht habt«, sagte ich zu Racheli, aber ohne Schadenfreude zu Verspüren.
Sie antwortete nicht, aber sie sah besorgt und verängstigt aus. Über uns
selbst sprachen wir jetzt nicht. Die Gedanken über unsere Zukunft belasteten
uns. Wie würde es in dieser neuen Lage mit uns weitergehen? Jetzt, da eine
Realität über uns hereingebrochen war, die die zerbrechliche Basis, auf der
wir ein gemeinsames Leben aufzubauen hofften, bedrohte. Wir vergaßen, warum
wir eben noch böse auf einander gewesen waren. Wir gingen hinunter auf die
Straße. In kleinen Gruppen standen da Leute, die nicht weniger verwirrt und
besorgt waren als wir. Als wir wieder hinaufgingen, kam uns im Treppenhaus
ein Offizier entgegen, der noch in aller Eile sein Hemd zuknöpfte. Dann
hörten wir wieder Sirenengeheul und liefen mit allen anderen zum nächsten
öffentlichen Luftschutzkeller. Plötzlich wurde mir klar, dass für mich in
diesem Unterstand kein Platz war. Ich blieb draußen am Eingang stehen und
sagte zu Racheli, dass ich nicht rein könnte. Sie würden fragen, wie es sein
könnte, dass ein junger gesunder Mann wie ich sich im Unterstand versteckt,
anstatt in den Krieg zu ziehen. Schnell liefen wir die Treppen hinauf zurück
nach Hause, verriegelten die Tür hinter uns und setzten uns hin.
Schwitzend und außer Atem sah ich auf die Wände, die mir während der ganzen
Jahre Schutz gegen die draußen herrschende Realität gegeben hatten, so wie
ich aus der Liebe zwischen Racheli und mir immer Kraft und Mut geschöpft
hatte. Ich glaubte, jetzt würde alles zusammenbrechen und ich würde allein
dastehen, rechtlos und Gewalttätigkeiten ausgesetzt. Ich sagte zu Racheli,
ich glaubte nicht, dass außer mir und den Alten, Frauen und Kindern noch
jemand im Haus bleiben würde - ein einziger Mann, der nicht in den Krieg
gezogen ist. Das würde bei den Leuten sicher Aufmerksamkeit, Staunen und
Verwunderung erregen. Es gäbe keine andere Möglichkeit, ich müsste so
schnell wie möglich von hier weg. Sie weinte und bat mich, doch bei ihr zu
bleiben.
Doch schließlich sah sie ein, dass das zu gefährlich wäre, und dass wir uns
vorläufig trennen müssten. Ich wollte sie mit meiner ganzen Kraft beruhigen
und sagte ihr, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, und dass der Krieg
nicht bis hierher kommen würde. »Sobald alles vorbei ist, leben wir unser
Leben weiter wie früher«, sagte ich ihr, obwohl ich selbst nicht wusste, wie
es zwischen uns weiter gehen würde. Schweren Herzens trennten wir uns.
An Busbahnhof standen hauptsächlich Soldaten in Uniform in einer langen
Schlange. Sie unterhielten sich über die Lage, was wohl wirklich geschehen
wäre, und warum sie nicht früher über den kommenden Krieg informiert worden
wären. Sonderbar, dass sie auch jetzt noch nicht wussten, was los war.
Als ich in mein Wohnviertel und zum Haus meiner Eltern kam, sah ich Leute
von der Haga, der Luftschutzorganisation, am Eingang, die nur Bewohnern den
Eintritt gestatteten, aber bis auf Ausnahmefälle niemanden hinausließen. Ich
saß mit einem Freund, der zu Besuch war, im Garten und wir verfolgten die
Nachrichten. Wir wechselten von einem Sender zum anderen und konzentrierten
uns schließlich auf den ägyptischen. Anders als im Sechstagekrieg klangen
die Nachrichten dort glaubwürdig. In unserem Haus konnten wir aus den nahe
gelegenen Wohnungen jüdischer Nachbarn oft Weinen hören und auch
herzzerreißendes Schreien, das uns sehr erschütterte. Später erfuhren wir,
dass ein Familienmitglied gefallen war. Neben dem Mitgefühl über den Verlust
eines Lieben befürchtete ich aber auch, dass einer der Hinterbliebenen die
Fassung verlieren und versuchen könnte, sich an uns zu rächen. Aber nichts
dergleichen geschah, obwohl die Stimmung sehr gedrückt war. Die Trennung von
Racheli wurde mir immer schwerer. Täglich rief ich sie an, um mich zu
versichern, dass alles bei ihr in Ordnung war und ihr zu sagen, dass ich
mich nach einem Wiedersehen sehnte.
Als der Krieg vorbei war, ging ich zu Racheli zurück. Alles schien
unverändert. Unsere freie Zeit verbrachten wir hauptsächlich in der Wohnung.
Im Gegensatz zu mir vertrieb sich Racheli lieber zuhause die Zeit statt
auszugehen.
Ich zog es vor, auch nicht mehr allein auszugehen, es war mir klar, dass ich
mich nicht mehr wie früher würde allein vergnügen können. Man könnte sagen,
dass wir wie andere Pärchen lebten: Arbeit, gemeinsames Essen, Zeitung
lesen, Fernsehen und Gespräche über alltägliche Dinge; manchmal auch kleine
Streitigkeiten, die zu längerem Schweigen führten, kleine Aufmerksamkeiten
und sexuelle Liebe. Ich vertraute ihr wie niemandem sonst. Ich fand bei ihr
eine seltene Kombination aus naiver Ehrlichkeit, Edelmut und Zartgefühl —
und eine starke Persönlichkeit, die genau wusste was sie wollte. Ich fühlte
mich in ihrer Gegenwart immer sicher und ausgeglichen. Während dieser Zeit
konnte Racheli sich ein kleines Auto kaufen, mit dem sie mich morgens zur
Arbeit brachte. Ganze Tage und manchmal auch Wochen lang kümmerten wir uns
nur um unser tägliches Leben. Ohne uns Rechenschaft abzulegen, Fragen zu
stellen oder an die Zukunft zu denken.
Wie viele andere Leute im Land wurden auch wir von dem Lotto-Virus
angesteckt. Auf die eine Hälfte des Scheins schrieben wir ihren Namen und
auf die andere Hälfte meinen. Nie schrieben wir beide Namen auf denselben
Schein. Sogar dabei war Racheli besorgt, jemand könnte merken, dass sie eine
Verbindung mit einem Araber hat. Sie bat mich sogar, die Scheine bei zwei
verschiedenen Kiosken abzugeben. Ihren Schein in der Nähe ihrer Wohnung und
meinen weit davon entfernt. Sie wollte keinerlei Zeichen oder Hinweise, dass
wir zusammen wohnten. Aber wir hatten abgemacht, dass, falls einer gewinnt,
er dem anderen die Hälfte abgibt. Das ist nur ein kleines Beispiel für unser
Leben, das sich einerseits quasi im Untergrund abspielte, wir einander
anderseits jedoch absolut vertrauten.
Racheli kochte ausgezeichnet. Sie konnte jedes Rezept, dass sie von einer
ihrer Freundinnen bekommen oder in einem Kochbuch gefunden hatte, in einen
Leckerbissen verwandeln. Mein Lieblingsgericht war eine Pilzsuppe, die sie
kochte, bis schließlich auch ich ein Meister im Zubereiten dieser Suppe
wurde. Wenn sie die Suppe zu lange auf dem Feuer ließ, machte ich sie darauf
aufmerksam, dass sie diesmal die Suppe länger als nötig auf dem Feuer ließ,
und wenn sie die Suppe mal vor der Zeit von Feuer nahm, wusste ich ihr genau
zu sagen, wie viele Minuten das waren. Sie war nicht beleidigt, ganz im
Gegenteil, sie lachte, da sie wusste, dass ich recht hatte. Pilzsuppe kam
des öfteren auf den Tisch. Eines Tages fragte Racheli mich, ob ich sie noch
nicht über hätte. »An dem Tag, an dem mir diese Suppe überdrüssig wird,
werde ich auch aufhören dich zu lieben«, antwortete ich. Obwohl ich es mit
Humor sagte, erinnerte sie sich oft daran und fragte mich von Zeit zu Zeit,
»Magst du diese Suppe immer noch?«, und schaute mir dabei mit einem Lächeln
in die Augen. »Ja, sicher, ich liebe sie!«, antwortete ich dann.
An Tagen, an denen ich wegen Schwierigkeiten bei der Arbeit nervös und
angespannt heimkam, konnte Racheli mich beruhigen, und ich zog Kraft aus
ihren Worten, wenn sie mit Sicherheit sagte: »Mach dir keine Sorgen, Sami,
alles wird gut.« Ich brauchte diese Sicherheit und Gelassenheit, die sie
ausstrahlte. Oft kam ich erregt nach Hause und erzählte Racheli, was mir
alles bei der Arbeit passiert war. Als ich in einem Wohnhaus gegen Abend mit
dem Tapezieren fertig war, kam der Eigentümer und sagte, dass es bereits zu
spät sei um jetzt noch abzurechnen, und wir sollten uns morgen um acht Uhr
mit ihm treffen und abrechnen. Ich war damit einverstanden. Als ich am
nächsten Morgen pünktlich mit meinem Mitarbeiter dort ankam, war der Mann
nicht da. Ich hatte geplant, direkt anschließend eine neue Arbeit zu
beginnen, so aber mussten wir auf der Straße herumstehen und auf den Kunden
warten. Dabei sah ich, dass uns eine Frau hinter einem Fensterladen im
ersten Stock beobachtet. Ich bekam ein ungutes Gefühl und schlug vor,
unterdessen in der Nähe einen Kaffee trinken zu gehen. Der Kunde komme
sowieso zu spät. Als wir zurückkamen, war der Kunde immer noch nicht da.
Auch eine halbe Stunde später nicht. Ich regte mich auf. Wir sagten uns:
»Wenn jemand etwas von dir will, kommt er schnell und jagt dich, wenn er
aber bezahlen muss, dann eilt nichts mehr.« Ich schickte meinen Mitarbeiter
in das nur hundert Meter entfernte Möbelgeschäft des Kunden, um nachzusehen,
ob er dort vielleicht wäre. Ich blieb wo ich war, um auf ihn zu warten. Nach
fünf Minuten sah ich mich von drei Männern umringt.
»Was machst du hier?«, fragte einer in scharfem Ton, »gib mir deinen
Personalausweis!« »Wer bist du, dass ich dir meinen Ausweis zeigen muss?«,
fragte ich zurück. »Ich bin von der Polizei«, antwortete er. »Dann zeig du
mir deinen Ausweis.« Er zeigte ihn mir und fragte, wo der Mann wäre, der
vorhin bei mir gewesen sei. Ich erklärte ihm, weshalb ich dort stünde und
wohin ich meinen Gehilfen geschickt hatte.
»Geh dort in den Hauseingang, nimm deine Hände hoch und lehne dich an die
Wand«, befahl mir der Polizist. Es blieb mir nichts anderes übrig, ich tat,
was er befahl. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen, ihn zu fragen: »Hast
du etwa gestern Abend >Hawaii Fünf-Null< gesehen?«
In diesem Moment kam mein Gehilfe zurück. Obwohl er erschrak, als er mich so
sah, sagte er mir, der Hausherr lasse mir ausrichten, dass er noch kurz
beschäftigt sei und in zehn Minuten kommen würde.
»Komm her«, befahl ihm der Polizist, »nimm du auch deine Hände hoch und
stütz dich hier an die Wand.« Der Polizist und seine Kollegen tasteten uns
ab und dann fragte er meinen Gehilfen, einen jungen Burschen von erst
siebzehn Jahren, dem die Angst vom Gesicht abzulesen war: »Woher kommt er?«,
und zeigte auf mich. »Er kommt von seiner Freundin«, antwortete er. »Und wo
wohnt die?« Der Junge nannte den Namen der Stadt. Jetzt fühlte ich die Angst
in mir aufsteigen und innerlich verfluchte ich seine dumme Naivität. Ein
Polizist sagte zu einem Kollegen mit beißendem Spott: »Schau mal an, es
sieht ganz so aus, als hätte er eine jüdische Freundin.«
Zum Glück kam in dieser Minute der Hausherr, in Begleitung seiner Frau. Die
wussten natürlich nicht, dass die Männer bei uns Polizisten waren. Der
Wohnungsinhaber sagte zu mir: »Die Verspätung tut mir Leid, komm in die
Wohnung damit wir abrechnen können.«
»Dadurch dass du zu spät gekommen bist, hast du mich ganz schön in
Bedrängnis gebracht«, sagte ich zu ihm.
»Wer sind Sie«, fragte der Polizist den Eigentümer der Wohnung. Er erklärte
es ihm, und auf eine weitere Frage sagte er, dass wir für ihn die Wohnung
tapeziert hätten und er uns jetzt bezahlen wolle.
Aber die Polizisten gaben nicht nach, sie wollten ihre Beute — und zwar
sofort. Seine Frau konnte nicht verstehen, um was es ging. Sie wollte
abrechnen und gehen. »Was ist denn mit diesen Burschen?«, fragte sie, »was
haben sie verbrochen?« Der Polizist herrschte sie an: »Scheren sie sich
weg!« »Wo sind wir denn hier? In Russland?«, entgegnete die Frau empört.
»Noch ein Wort und ich verhafte Sie!«, drohte der Polizist. Die Frau wurde
bleich, hielt sich am Arm ihres Mannes fest, und beide gingen fort.
Mir und meinem Gehilfen befahlen die Beamten, mit ihnen zu kommen. Ich war
schockiert. Ich konnte keinen Grund der Welt sehen, weswegen ich mit ihnen
gehen sollte, außer dem einen immer gleichen. Wir stiegen in einen weißen
Ford Cortina ein. Zwei von ihnen saßen vorne und der Dritte saß mit uns
hinten. Er hatte nicht vergessen, dass ich von meiner jüdischen Freundin
gekommen war und sagte zu seinen Kollegen:
»Dieser Araber hat 'ne jüdische Freundin, bei der er wohnt«, und dann wandte
er sich an mich und wollte wissen, wer sie sei und ihre Adresse.
»Versuch doch, es mit Gewalt herauszubekommen«, war meine Antwort, »du hast
kein Recht mich über meine Freundin auszufragen. Es gibt kein Gesetz, das
mir als Araber verbietet, der Freund einer Jüdin zu sein. Sobald es mal so
ein Gesetz gibt, werde ich dir auch auf deine Frage antworten.« Noch hatte
ich meine Antwort nicht zu Ende gesprochen, da wusste ich schon, dass ich in
eine Falle geraten war. Die Polizisten wussten genau, dass ich mir nichts
hatte zuschulden kommen lassen, sie suchten nur irgendetwas, um es mir
anzuhängen. Als wir zum nördlichen Polizeirevier kamen, wurden wir von einem
jungen uniformierten Polizisten in sein Zimmer gebracht. Er blätterte in den
Papieren, die vor ihm auf seinem Tisch lagen, und es war zu erkennen, dass
er nicht genau wusste womit zu beginnen. Aber für uns hatte er nicht mal ein
leichtes Lächeln übrig.
»Wo ist es?«, fragte er schließlich. »Was meinst du?«, wollten wir wissen.
»Die Uhr!«, sagte er, wandte sich an mich und erklärte: »Du wärst
beschuldigt, eine Uhr aus der Wohnung gestohlen zu haben.« »Du machst Spaß«,
reagierte ich. »Sag mir, wie viel du verdienst.« »Ich verdiene in zwei, drei
Tagen soviel wie du in einem Monat, ich hab es nicht nötig, eine Uhr zu
stehlen, und jetzt kommst du und sagst mir, dass ich eine Uhr gestohlen
habe. Zeig mir den Menschen, der dir das gesagt hat.« »Gut, ich weiß es
nicht, mein Job ist es, dich zu verhören.«
Er rief den Polizisten, der uns verhaftet hatte, zeigte ihm die Papiere mit
unserer Erklärung ... pp 106, 107ff...
hagalil.com
27-03-04 |