|
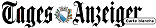
DAS BUCH
Wenn aus Mördern Lämmchen werden
Ein Unbekannter schreibt einen Zeitroman wie Hans
Fallada: Bernd Späths «Trümmerkind» ist ein aufregender Solitär in der
Bücherlandschaft.
Von Peter Glotz
Fürstenfeldbruck ist eine Kreisstadt nicht weit von
München, ein reputierliches Mittelzentrum mit idyllischen Bauerndörfem
im westlichen und nach München tendierenden Industrievorstädten im
östlichen Landkreis. Es gibt da ein berühmtes Kloster, einen
Militärflugplatz und effiziente Einser-Juristen in Trachtenanzügen als
Landräte. Kein vernünftiger Mensch könnte sich vorstellen, was gegen
diese Stadt zu sagen wäre.
Ausser Bernd Späth, Bäckerssohn aus Fürstenfeldbruck,
das die Einheimischen Brück nennen. Der Mann, heute knapp über fünfzig,
betreibt inzwischen im Rheinland eine Presse- und Event-Agentur. Jetzt
aber hat er seinen Bruckern einen vierhundertseiten-Roman auf den Tisch
geknallt, der es ihm schwer machen wird, im «Martha-Bräu» ein Weissbier
zu trinken.
Wieder die «Wilhelm Gustloff»
Späths unverfälscht autobiografisch gefärbtes Porträt
der kleinen Stadt in den 5oer- und 6oer-Jahren ist das gnadenlose
Sittenbild nach-nazistischer Anständigkeit in der deutschen Provinz. Ein
wortgewaltiger Bayer beschmutzt sein eigenes Nest. In der Flut
artifizieller Kunstprosa, mit der die Buchhandlungen zugeschüttet
werden, ist diese gelegentlich ungefüge Anklageschrift ein aufregender
Solitär. Späth hat den Schlüsselroman einer schmucken Kreisstadt
geschrieben, die nicht ganz so schmuck ist, wie sie sich gibt. Ein
spannend geschriebener und gelegentlich auch erschütternder
Gesellschaftsroman aus der Perspektive der untersten Mittelschicht einer
kleinen bayrischen Stadt in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg.
Der Vater der Hauptfigur ist zuerst Bäcker, später
Versicherungsmakler; der Sohn kleinster Verhältnisse, dem Hitler mit
seinem Krieg fünf Jahre seines Lebens nahm. Nach seinem Tod findet der
Sohn eine handschriftliche Notiz: «Da wird man zum Soldaten gemacht und
ausgebildet und lernt zu töten und zu töten und zu töten. Und dann ist
auf einmal alles vorbei, und man soll plötzlich wieder leben wie ein
Lämmchen.» Ein Lämmchen war dieser muskelbepackte Mann, der seinen
besoffenen Schwiegervater zwei Treppenabsätze hinaufwerfen konnte,
nicht. Reiner Zufall, dass auch er mit der «Wilhelm Gustloff» zu tun
hatte, die Günter Grass gerade in den Mittelpunkt seines
Vertreibungsromans gestellt hat. Der Bäckermeister Achinger, der
Hunderte von treibenden Leichen um die «Wilhelm Gustloff» herum hatte
aufsammeln müssen, wurde diesen Krieg nie wieder los. Aber eben auch
nicht den Hass auf die Juden, die an all dem Schuld waren, den Hass auf
die Amerikaner, die ihn bei seiner Rückkehr aus dem Krieg auf
irgendeinem Bahnhof halb tot geschlagen hatten, den Hass auf die Mörder
seiner Kameraden, die mit 19 Jahren von irgendwelchen Flammenwerfern
getötet wurden.
Späth beginnt seinen Roman aus der Perspektive des
vier-, fünfjährigen Kindes in den 50er Jahren. Juden gibt es in
Fürstenfeldbruck nicht mehr. Aber der Roman beginnt mit dem Satz: «Über
den Jud an sich, net war, also da hatten sie mich ja frühzeitig
informiert.» Einen einzigen Juden lernt er schliesslich kennen, den
Besitzer eines Hosengeschäftes. Der ist liebenswürdig. Aber wo ist seine
Familie? Niemand weiss es. «Mei, war das ein Elend», hatte die Oma des
Erzählers irgendwann erzählt. Die Nazis hatten noch im April 1945 die
Gefangenen aus dem Lager Kaufering durch Fürstenfeldbruck getrieben. «I
hab sofort d' Vorhäng' zug'macht! Jessgus naa, ja so ein Elend. Na, na,
na!» Vergangenheitsbewältigung in Fürstenfeldbruck, man machte die
Vorhänge zu.
Kinder mit Waffen
Auch Flüchtlinge wurden in dieser Stadt einquartiert. In
der Regel lebten sie, jedenfalls kurz nach dem Krieg, in einer
besonderen Siedlung. Die sanitären Verhältnisse waren - wie oft in
diesen Jahren, und nicht nur in Fürstenfeldbruck - katastrophal. Das
rührte dazu, dass die Kinder gelegentlich stanken. Wer aber stank, wurde
verprügelt. Fünf Einheimische gegen einen Flüchtlingsjungen, wenn sie
ihn irgendwo gefahrlos erwischen konnten. So ein Junge wurde schnell zum
«Loser». Eines der Kapitel Späths, «Loser Luttenwang», ist ein
Kabinettstück über die Verrohung eines Menschen. Der Schulfreund des
Erzählers, der bald den Spitznamen Loser bekommt und immer wieder
verprügelt worden war, wird natürlich für einige Zeit zum Anführer einer
Gang von Halbwüchsigen, die andere Kinder zusammenschlagen, bis ihre
Gesichter nur eine blutige Masse sind. Späths Bericht über einen
Konflikt mit dieser Bande ist ein Stück bedeutender Literatur. Loser
Luttenwang schlägt den zitternden Erzähler, der sich endlich wieder auf
irgendein Tanzvergnügen getraut hat und eine Gaspistole in der Tasche
trägt, nicht zusammen. Er erinnert sich daran, dass die beiden jetzt
vielleicht Siebzehnjährigen als Fünfjährige miteinander freundlich
gespielt hatten. Das allerdings führt dazu, dass er endgültig ein Loser
wird. Er verliert den Anführerstatus in seiner Gruppe.
«Trümmerkind» ist
auch ein Beitrag zur
empirischen Pädagogik
- von ganz unten.
Wie Späth schildert, was in dem reputierlichen Gymnasium
der Stadt damals schon stattfand, wie Kinder angsterfüllt durch die
Stadt schlichen, weil sie nicht wussten, ob an der Ecke nicht
irgendwelche Schläger warteten und dass es Klassen gab, in denen - wir
schreiben die frühen 60er-Jahre - schon damals viele Kinder mit Waffen
herumliefen, ist ein erhellender Beitrag zur empirischen Pädagogik und
von ganz unten.
Natürlich, vom Standpunkt der professionellen
Literaturkritik kann man manches gegen Späths Roman einwenden. Die
eindrucksvolle Kindheitsgeschichte in der ersten Hälfte könnte ohne
weiteres um 80 Seiten kürzer sein. Manche Liebesszenen sind entgleist.
Gelegentlich schleichen sich «kardiale Befunde» und «weltanschauliche
Fundamentalisten» in den Text. Keine Rede von Handkes Sprachdisziplin
oder von Walsers Fähigkeit, eine kleinbürgerliche Suada als inneren
Monolog zu präsentieren. Nur ist die Schilderung, wie sich der in einem
Altenheim im Dorf Jesenwang dahindämmernde Opa, inzwischen fast blind,
an irgendwelchen Lattenzäunen entlangtastet, um Tag für Tag noch ins
Wirtshaus zu kommen, genauso erschütternd wie die Erzählung von dem
Kind, das mit seinem Dreirad durch Brück fuhr, um die Mutter zu suchen,
die dem Vater mit einem Kapitän davongelaufen war. Mit Feuchtwangers
«Erfolg» kann man Späths «Trümmerkind» nicht vergleichen, wohl aber mit
ein paar Texten von Hans Fallada oder August Kühn. An der Uni München
gibt es einen Lehrstuhl für bayrische Literaturgeschichte. Späth hat den
Studierenden an diesem Institut neuen Stoff geliefert, spannenden Stoff.
tagesanzeiger, zürich, 12-03-02
Bernd Späth: Trümmerkind.
Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 2002.420 S; 42 Fr.
Trümmerkind jetzt auch als Taschebuch
Bestellen?
hagalil.com
17-06-02
|