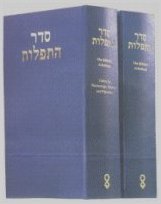
Die Geschichte des Volks des Buches spiegelt sich
auch in der Geschichte seiner Bücher...
...daß heute in Deutschland wieder ein neues jüdisches Gebetbuch
erscheint, daß Gebete für den G'ttesdienst in neuen Gemeinden neu
interpretiert und verlegt werden, zeigt uns, daß das Judentum in Deutschland
lebendig ist. Ein Vortrag von Rabbiner
Prof. Dr. Jonathan Magonet, anlässlich des Erscheinens
des ersten vollständigen neuen Gebetbuchs in Deutschland nach der Shoah:
Ein Gebetbuch ist in gleicher Weise der öffentlichste und
der intimste Ausdruck jüdischer Wertvorstellungen und Erfahrungen. Es ist
der beste Zugang, um einen Einblick in die Seele des jüdischen Glaubens zu
erhalten, aber in gleicher Weise auch ein Zeugnis der täglichen Kämpfe, die
in dieser Seele stattfinden. Als Ergebnis einer jahrhundertelangen
Entwicklung finden sich in einer Liturgie die höchsten Ziele eines Volkes
oder einer Glaubensgemeinschaft, aber in gleicher Weise auch die
gespenstischen Spuren vergangener Streitigkeiten und Spaltungen. Gerade weil
eine Liturgie eine öffentliche Bekundung und ein öffentliches Bekenntnis
ist, bündelt sie das Selbstverständnis einer bestimmen Gemeinde zu einer
bestimmten Zeit. Sie bestärkt die Verbundenheit derer, die sich selbst als
Teil der jeweiligen Gemeinde fühlen. Gleichzeitig aber - sei es mit oder
ohne Absicht - schließt sie andere aus, die sich dieser bestimmten Gemeinde
oder dieser bestimmten Form des Gottesdienstes nicht anschließen können.
Weil die Liturgie aber die Einsichten vergangener
Generationen widerspiegelt, die diese bestimmte Gemeinde geprägt haben, ist
sie auch der Boden und manchmal das - allerdings oft gut getarnte -
Schlachtfeld, auf dem neue Erfahrungen, Ansichten und Einstellungen
durchdacht, erprobt oder in der Öffentlichkeit durchgesetzt werden. Dies ist
der Grund, warum eine Liturgie vereint und trennt. Sie ist definierender
Text, ein definierendes Geschehen.
In gleicher Weise, wie eine Liturgie gemeinsame
Erfahrungen und Bekenntnisse möglich macht, so gibt sie auch den Rahmen für
private Freiräume und persönliche Andacht. Die Stille zwischen den
Worten ist so wichtig wie die Worte selbst.
Eine Liturgie - welchen Inhalts auch immer - kann Menschen
von Kindheit an begleiten und zu bestimmten Zeiten eine besondere Bedeutung
bekommen. Dadurch prägt sie sich tief in unser Herz und unser Bewusstsein
ein. Sie symbolisiert für uns etwas Ewiges, Verlässliches und Sicheres,
selbst wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Dies ist sogar dann der
Fall, wenn die Texte an sich der Person, die sie spricht oder hört, wenig
bedeuten, sei es, weil sie vor so langer Zeit entstanden sind, oder weil sie
eine unbekannte Sprache verwenden oder weil der Rhythmus und die
Sprachmelodie sie mit der Zeit zu einer Art Mantra werden ließen. Und doch:
Verändert man ein Wort oder eine Silbe, eine Melodie oder die Reihenfolge
bestimmter Gebete, dann wird man die heftigsten Gefühle auslösen. Da ist das
Wissen wenig tröstlich, dass selbst die radikalsten Änderungen in einigen
Jahren so vertraut sein werden, als hätten sie schon "seit Ewigkeiten"
bestanden. In dem Moment, in dem etwas verändert wird, empfindet man es
trotzdem nur als bedrohlich und betrüblich. Wir unterschätzen die Macht von
Ritual und Liturgie auf eigene Gefahr.
Eine neue Liturgie für das deutsche Judentum
Mit dem Gesagten soll eine neue Liturgie für das deutsche
Judentum vorgestellt werden. Sie ist nicht gänzlich neu, denn die Versionen
der traditionellen Gebete, die hier verwendet werden, sind die, die zur Zeit
auch in den Reformsynagogen Großbritanniens in Gebrauch sind. Diese wiederum
sind durch eine ganze Anzahl von Entwicklungen beeinflusst worden, deren
Ursprung sich bis zu den Anfängen der Reformbewegung in Deutschland
vor fast zwei Jahrhunderten zurückverfolgen lässt. Man findet die
Spuren des letzten und des Beginns dieses Jahrhunderts, in denen man etliche
traditionelle Texte radikal verwarf, ebenso wie diejenigen der Zeit nach dem
Krieg, als der starke Wunsch nach Re-Integration dieser Texte entstand.
Die Geschichte des liberalen Judentums ist aufs engste mit
der Arbeit an einer Liturgiereform verbunden. Jüdinnen und Juden, die die
Gettos verlassen hatten, sahen die Notwendigkeit, ihre Gottesdienste an die
neuen Umstände anzupassen: Der Gottesdienst selbst sollte mit Ästhetik
gestaltet sein. Musik, Orgel und Chor sollten die Schönheit der Gebete
stärker zum Ausdruck bringen. Männer und Frauen sollten gleichberechtigt
sein und nebeneinander sitzen. Die Texte, die gebetet werden, sollten
verständlich sein, von daher konnten sie auch in der Landessprache gelesen
werden (etwas, das bereits die rabbinischen Quellen erlaubt hatten [Sota
32a], das aber nur selten zur Kenntnis gekommen wird.) Einige theologische
Ideen, wie die Auferstehung der Toten, die Wiedererrichtung des Tempels und
seines Opferkultes und der Glaube an Engel erschienen nicht mehr zeitgemäß.
Die Gefühle von Optimismus und Universalismus, die das 19.Jahrhundert
weitgehend prägten, weckten bei emanzipierten Jüdinnen und Juden ein
Unbehagen über den engen Nationalismus und Partikularismus in vielen
Gebeten. Außerdem führte die Entwicklung der wissenschaftlichen
Beschäftigung mit den jüdischen Quellen zu dem Wunsch, die originalen,
"reinen" Formen zu finden und die vermeintlichen Anreicherungen, die
aufgrund der langen Erfahrung von Exil und Leid entstanden waren, zu
entfernen.
Unter den buchstäblich Hunderten von neuen Gebetbüchern,
die seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die dreißiger Jahre dieses
Jahrhunderts in Deutschland erschienen sind, bildeten sich zwei Grundtypen
heraus: In einigen wurde versucht, das traditionelle Gebetbuch durch
Kürzungen und Überarbeitungen zu verändern, dabei aber Form und weite Teile
des Inhalts zu bewahren. Andere waren radikaler und eher Anthologien
jüdischer Gebete, in der Regel in Deutsch zitiert, mit einigen "klassischen"
Abschnitten wie das Shm'a in Hebräisch. Diese deutschen Neuerungen
verbreiteten sich im ganzen westlichen Europa und in Amerika und bewirkten
auch dort einen Ausbruch liturgischer Kreativität. Obwohl das
deutsche liberale Judentum, wie so vieles andere, von den
Nationalsozialisten vernichtet worden ist, schuf es sich weiterhin
Ausdrucksmöglichkeiten, wo immer die Flüchtenden eine neue Heimat fanden.
In Großbritannien wurde die Tradition der Gebetbuchreform in zwei religiösen
Strömungen fortgesetzt: der Reformbewegung und der liberalen Bewegung. Die
Gebetbücher der ersteren, die drei Bände der Forms of Prayer for jewish
Worship der Reform Synagogues of GreatBritain (RSGB) bilden die Grundlage
für die beiden neuen deutschen Gebetbücher. Der erste Band enthält die
Daily, Sabbath and Occasional Prayers (5737 - 1977) und die Prayers for the
Pilgrim Festivals (5755 - 1995). Der zugehörige zweite Band beinhaltet die
Prayers for the High Holydays (5745 - 1985).
Wenn wir heute diese besondere Form des jüdischen
Gottesdienstes anbieten, dann wollen wir damit nicht die Legitimität anderer
Formen in Frage stellen, weder die sehr traditionellen noch die ganz
radikalen. Die jüdische Welt ist zur Zeit so vielfältig wie nie
zuvor, und wir haben die Freiheit, die Form der Worte zu wählen, die unserem
Glauben und unserer Wesensart am meisten entspricht. Aber es ist hilfreich,
einen Ausgangspunkt zu haben, vor allem in der sich so schnell verändernden
Situation der Gemeinden in Deutschland. In diesem Gebetbuch finden wir die
Gebete aus unserer Tradition, die auf eine bestimmte Art und Weise an die
heutige Zeit angepasst wurden. Sie können von den verschiedenen
Gemeinden auf verschiedene Weise benützt und verändert werden - und gerade
dies sollte auch so sein!
Es wurde einmal gefragt, warum der traditionelle
erste Abschnitt der Amidah von dem "Gott Abraham, Gott Isaaks und Gott
Jakobs" spricht und nicht einfach von dem "Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs". Die Antwort ist: Jeder der Patriarchen musste Gott auf seine eigene
Weise finden, auf der Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Zeit. Dies ist
heute unsere Herausforderung- und gleichermaßen die Suche nach dem Gott
Saras, Gott Rebekkas, Gott Rahels und Gott Leas.
Rabbiner Prof. Dr. Jonathan Magonet
Das britischen Original ist von Rabbiner
Lionel Blue und Rabbiner Jonathan Magonet unter Leitung der Assembly of
Rabbis of the RSGB herausgegeben worden.
Die deutsche Übersetzung wurde von
Annette Böckler erstellt, unterstützt von Gesine Popp und Lydia Lusch, unter
Aufsicht von Rabbiner Prof. Dr. Jonathan Magonet. Das Prinzip der
Übersetzung war, eine möglichst genaue Übertragung der hebräischen,
aramäischen und englischen Texte mit einer liturgisch angemessenen deutschen
Sprache zu verbinden. Die Übersetzerin ging von den hebräischen und
aramäischen Originalen der Gebete aus. Wo es jedoch das Verständnis der
Texte deutlicher zum Ausdruck brachte, folgte sie den Interpretationen der
englischen Übersetzungen der Forms of Prayer. Es wurde durchgängig versucht,
die Übersetzung in einem nicht-exklusiven Sprachstil zu gestalten. Der Name
Gottes, das Tetragramm, ist deswegen an den meisten Stellen mit dem Wort
"Gott" wiedergeben, das für verschiedene Gottesvorstellungen offen ist, an
einigen Stellen wird - der von Moses Mendelsohn begründeten Tradition
folgend - "der Ewige" verwendet, oder er wurde, je nach Kontext, durch
andere Begriffe ersetzt, die besondere Eigenschaften Gottes ausdrücken.
Die Initiative zu einem solch großen Projekt, das
erste vollständige neue Gebetbuch in Deutschland erscheinen zu
lassen, kam von Rabbiner Dr. Dr. Walter Homolka. In seiner Hand lag die
Organisation der Veröffentlichung.
[BESTELLEN
(Zwei Bände)] [BESTELLEN
(Erster Band)]
juedische-verlagsanstalt.de
|