|
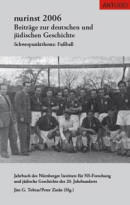
Jim G. Tobias / Peter Zinke (Hg.):
nurinst 2006
Beiträge zur deutschen und jüdischen Geschichte
Schwerpunktthema: Fußball
Jahrbuch des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte
des 20. Jahrhunderts
Antogo Verlag 2006
Euro 12,80
Bestellen?
"Ihr Gewissen war rein; sie haben es nie benutzt":
Die Verbrechen der
Polizeikompanie Nürnberg
"Nächstes Jahr im Kibbuz":
Die Zionistische
Ortsgruppe Nürnberg-Fürth |
Beiträge zur deutschen und jüdischen Geschichte:
Jahrbuch mit Schwerpunkt Fussball
Von Andrea Livnat
Die Fussball WM gab dem Jahrbuch des Nürnberger
Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts 2006
seinen Schwerpunkt. Auch wenn es in den letzten Jahren verstärkt Forschung
und Veröffentlichungen zu diesem Thema gab, dürfte vielen weiterhin nicht
bekannt sein, dass unter den Fussballpionieren und Spitzenspielern
Deutschlands zahlreiche Juden waren.
Publikationen der vergangenen Jahre, wie beispielsweise "Davidstern
und Lederball", aber auch Ausstellungen, wie "Verdient und doch
vergessen. Elf Juden im deutschen Fußball" im Jüdischen Museum Berlin,
stellten vor allem einzelne jüdische Spieler und Mäzene vor. Da ist etwa
Gottfried Fuchs zu nennen, der erste jüdischen Nationalspieler und bis heute
Tor-Rekordhalter, der 1912 bei den Olympischen Spielen in einem einzigen
Spiel zehn Treffer erzielte. Oder der Nationalspieler Julius Hirsch, der in
Auschwitz ermordet wurde, Walter Bensemann, der 1920 die Zeitschrift
"Kicker" gründete. Oder Kurt Landauer, der von 1913-1933, sowie von
1947-1951 Präsident des "FC Bayern" war.
Das Jahrbuch stellt jedoch nicht die "spektakulären"
Persönlichkeiten und Beispiele der jüdischen Sportvertreter heraus, sondern
die eher leisen, jedoch nicht weniger interessanten Aspekte. Im Gegenteil,
es ist gerade der kulturgeschichtliche Blick auf die "Schattenseiten" des
Sports, der dieses Jahrbuch so lesenswert macht.
Bernd Siegler berichtet über die "Entjudung" des 1. FC
Nürnberg, der seine jüdischen Mitglieder bereits Ende April 1933 ausschloss.
Eckart Dietzfelbinger untersucht die Funktionalisierung des Fussballs durch
den Nationalsozialismus am Beispiel eines Spiels, das am 13. August 1939
zwischen der Spielvereinigung Fürth und der Stadtauswahl Danzig ausgetragen
wurde.
Nicola Schlichting zeigt, dass die Freude am Fussball
sogar im Konzentrationslager ungebrochen war und beispielsweise in
Theresienstadt regelmäßig Spiele stattfanden.
Jim G. Tobias widmet sich in zwei Beiträgen dem Fussball
der ausgewanderten und überlebenden Juden. Deutsche Juden gründeten 1938
eine eigene Mannschaft in New York, die in der Eastern District Soccer
League, einer von europäischen Einwanderern geprägten Liga, dominierend war.
Auch die Schoa-Überlebenden, die in den sogenannten DP-Camps auf ihre
Emigration warteten, formierten sich bald zu Fussball-Teams, die in
verschiedenen Regionalligen, sowie in der 1. Liga vertreten waren. Dieses
vollkommen unbekannte Kapitel der Geschichte der Displaced Persons
beleuchtet Jim G. Tobias durch die Auswertung der jiddischen Presse der DPs.
Peter Zinke widmet sich ebenfalls der Zeit nach 1945 und
der Wiedergründung von Hakoach Wien, der ehemals größte jüdische
Sportverein. In Gesprächen mit ehemaligen Aktiven arbeitet Zinke die
antisemitische Grundstimmung der Nachkriegsjahre in Österreich heraus, die
sich in Spielen gegen Hakoach entlud.
Fünf weitere Beiträge ergänzen das Jahrbuch um seinen
Schwerpunkt. Kurt Schilde zeigt die Skrupellosigkeit der Finanzbürokratie im
Nationalsozialismus exemplarisch anhand des jüdischen Ehepaars Elsbeth und
Erich Frey aus Berlin, die enteignet, nach Theresienstadt deportiert und
schließlich in Auschwitz ermordet wurden.
Ein ganz besonderes Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte
stellt Hans-Rainer Hofmann, Bürgermeister der Martkgemeinde Schopfloch, vor.
Schopfloch, das im Landkreis Ansbach/Mittelfranken liegt, ist die Heimat
einer mittlerweile fast ausgestorbenen jüdischdeutschen Sprache,
Lachoudisch. Hofmann gibt einen kurzen Überblick zur jüdischen Geschichte
Schopflochs und erklärt die Herkunft des Lachoudischen, das sich als Sprache
bei den jüdischen und christlichen Viehhändlern durchsetzte. In Schopfloch
sind bis heute etwa 200 lachoudische Wörter in Gebrauch, die im Jahrbuch
tabellarisch aufgelistet sind.
Die Geschichte des ersten Jüdischen Museums, das 1895 in
Wien eröffnet wurde, zeichnet Wiebke Krohn nach. Jutta Fleckenstein gibt
einen ersten Einblick in das neue Jüdische Museum München, Andreas Brämer
stellt das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg vor.
hagalil.com
07-07-06 |