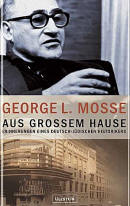
George L. Mosse:
Aus grossem Hause
Erinnerungen eines deutsch-jüdischen Historikers
Ullstein Verlag, Berlin 2003
Euro 24,-
Bestellen? |
Reich, jüdisch und talentiert:
Die Memoiren von George Mosse
Von Michael Brenner
Süddeutsche Zeitung, 13.10.2003
Wer in den achtziger Jahren in Jerusalem studiert hat,
wird sich an jene Seminare erinnern, in denen man sich ins Wilmersdorf oder
Schöneberg der zwanziger Jahre zurückversetzt fühlte. Ältere Damen mit
weißen Handschuhen lauschten gespannt einem ebenfalls nicht mehr ganz jungen
Herren, der in der Hebräischen Universität in leicht deutsch gefärbtem
Englisch über Rathenau und Freud und Tucholsky referierte. Er hätte freilich
auch seine eigene Familiengeschichte zum Besten geben können, um den
Zuhörern einen tieferen Einblick in die neuere deutsch-jüdische Geistes- und
Wirtschaftsgeschichte zu geben.
Aufgewachsen im märkischen Schloss Schenkendorf und einem Berliner
Stadtpalais, bewohnte George Lachmann Mosse als Junge einen ganzen
Schlossflügel und hatte bereits als Grundschüler seinen eigenen Chauffeur.
Der 1918 geborene jüngste Enkel von Rudolf Mosse, dessen Zeitungsimperium
(u. a. Berliner Tageblatt) im Kaiserreich kaum Konkurrenz hatte, gehörte zur
Elite des Berliner Bürgertums. Die Familiengeschichte der Mosses wurde
bereits in einer bedeutenden Studie von Elisabeth Kraus dokumentiert. Ihr
Nachwort bereichert diesen Band, an dessen deutscher Ausgabe nur der
unglückliche Titel stört.
Die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Welten machte sich in der
Stiftungstätigkeit der Familie bemerkbar. In Schenkendorf, wo er als eine
Art Gutsherr betrachtet wurde, stiftete der Vater, Hans Lachmann, die
Kirchenglocken; in Berlin richtete er Suppenküchen für die verarmte
Bevölkerung ein und finanzierte die Fräcke für die Philharmoniker; dem
Geiger Bronislaw Huberman schenkte er seine erste Geige, und auch Paul
Hindemith griff er unter die Arme; er half bei der Umgestaltung der Liturgie
für die Berliner Reformgemeinde und setzte Schallplatten im
Synagogengottesdienst ein.
Im Hause Mosse ging die Berliner Prominenz ein und aus, und als den jungen
George später im Schweizer Exil ein Hund ins Bein beißt, ist dies natürlich
nicht irgendein Straßenköter, sondern das Hündchen von Alfred Kerr. Die
spartanische Erziehung im Internat von Salem passte zu den bürgerliche
Tugenden, die im Haus Lachmann-Mosse herrschten. Hier wurde George Mosse
freilich auch mit einer völkisch-nationalen (wenn auch nicht
nationalsozialistischen) Erziehung konfrontiert, über deren Folgen er später
seine wichtigsten Bücher verfasste.
Man mag bei den Anfeindungen, die seine Familie erfuhr, an das Wort Max
Liebermanns denken: "Ich hatte zu viele Feinde, ich bot ja auch drei
Angriffsflächen: Ich war erstens Jude, zweitens reich, und drittens hatte
ich auch Talent." George Mosse war Außenseiter in vielfacher Hinsicht: als
Sohn einer der reichsten Berliner Familien, als Jude, als Emigrant, als
Homosexueller. Doch wer ihn kannte, weiß, dass Lamentieren nicht seine
Stärke war. So stellt er auch in den Memoiren fest, dass er trotz
Vertreibung und Neuanfang auf ein erfülltes Leben zurückblicken kann – und
dieser Blick erfolgt an keiner Stelle im Zorn.
Nach kurzem Aufenthalt in der Schweiz ging er weiter an ein englisches
Internat, studierte im britischen Cambridge und promovierte in Cambridge,
Massachussetts, an der Harvard Universität. Seine Karriere als Historiker
begann er an der Universität von Iowa als Spezialist für das
frühneuzeitliche Europa, bevor er später an seiner langjährigen Heimat, der
University of Wisconsin in Madison, seine Interessen immer mehr dem
Nationalismus und Totalitarismus zuwandte.
Einmal stellt er lapidar fest: Wäre er in Deutschland geblieben, "ich wäre
irgendwann in das Familienunternehmen eingetreten und dort geblieben." Wir
hätten so eine Reihe wichtiger Werke vermisst, über die völkischen Ursprünge
des Nationalsozialismus etwa oder über das Verhältnis zwischen Sexualität
und Nationalismus, über deutsch-jüdische Intellektuelle und über den Umgang
der Menschen mit dem massenhaften Sterben im Ersten Weltkrieg. Es sind
zumeist geistes- und mentalitätsgeschichtliche Studien, die in der
Bundesrepublik weniger en vogue waren und ihn so in seinem Geburtsland nie
auch nur annähernd den Ruf einbrachten, den er in seiner neuen Heimat
genoss.
Es spricht keine Unbescheidenheit aus seinen Memoiren, wenn er immer wieder
feststellt, dass er weniger auf seine Bücher als auf seine Leistungen als
akademischer Lehrer stolz ist. Mit Vergnügen berichtet er von einem Angebot
seiner Universität, ihn aufgrund seiner herausragenden Leistungen eine
besonders prestigereiche Professur zu verleihen, die nur zwei Stunden
Lehrtätigkeit erforderte. Zwar verblieb er an der ihm liebgewonnener
University of Michigan, bestand jedoch darauf, mindestens ein volles
Lehrdeputat unterrichten zu dürfen. Seine zahlreichen Schüler, von denen
eine ganze Reihe mittlerweile selbst klangvolle Namen haben, werden es ihm
gedankt haben. Als ihn im Laufe derselben Verhandlungen der Rektor der
Universität fragte, welchen Namen er denn für seinen eigenen Lehrstuhl
wünsche, schlug er spontan "Cartwright-Chair" vor und belehrte seinen etwas
verdutzten Vorgesetzten, er liebe nun einmal die TV-Serie "Bonanza" so sehr.
Stereotypen der Antisemiten
Das Schelmische spricht immer wieder aus diesen Memoiren, und doch liest man
zwischen den Zeilen auch von den vielen Barrieren, die sich im Leben eines
Menschen auftaten, dem bei seiner Geburt eine sorglose Existenz vorbestimmt
zu sein schien. Buchstäblich in letzter Minute flüchtete er zu Beginn der
NS-Herrschaft über den Bodensee in die Schweiz, in der Columbia University
wird er in den vierziger Jahren explizit abgewiesen, da die "Judenquote"
schon erfüllt war und bewegend beschreibt er, wie er zeitweise, einige
Stereotypen der Antisemiten verinnerlicht hatte. Erst als er seit den
siebziger Jahren regelmäßig als Gastprofessor an der Hebräischen Universität
in Jerusalem unterrichtete, hatte er mit seiner jüdischen Herkunft Frieden
geschlossen. Schwieriger war für ihn der Umgang mit seiner Homosexualität,
den er in seinen Memoiren als ein weiteres identitätsprägendes Moment
eingehend schildert.
Die Memoiren des 1999 verstorbenen George Mosse sind zugleich ein Stück
deutscher Kultur- wie auch Unkulturgeschichte. Sie berichten vom Leben eines
Historikers, der wie nur wenige seiner Kollegen Geschichte erfahren und
Geschichte geschrieben hat und mittlerweile selbst Objekt deutscher,
jüdischer und amerikanischer Kulturgeschichte geworden ist.
hagalil.com
04-05-05 |