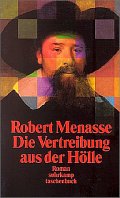
Robert Menasse,
Die Vertreibung aus der Hölle
Suhrkamp 2003
Euro 12,00
Bestellen? |
Wer waren unsere Lehrer? Mit
dieser Frage und ihrer – für die Lehrer – peinlichen Antwort läßt Viktor
Abravanel im Wien der 80er Jahre sein Klassentreffen platzen. Was folgt,
ist die Aufarbeitung eines halben Lebens als ewiger Außenseiter, Sohn
jüdischer Emigranten, 68er-Aktivist, männliches Opfer der Frauenbewegung
(ja, das gab's!) und streitbarer Historiker.
Und das vermischt sich mit der
Lebensgeschichte von Samuel Manasseh ben Israel, jüdischer Gelehrter zu
Hochzeiten der Inquisition, Begründer der jüdischen Presse in Amsterdam,
erfolgreicher Streiter für das Aufenthaltsrecht von Juden in England und
– Lehrer von Baruch Spinoza.
Lissabon zu Zeiten der Inquisition,
Wien unter den Nazis, Rembrandts Amsterdam und das Wien der 68er jeweils
aus der Sicht eines jüdischen Flüchtlingssohns – im ständigen
Wechselspiel zwischen den Zeiten und Welten nimmt Robert Menasse seine
LeserInnen gefangen und zieht sie in das gequälte Innere eines Kindes,
das vergeblich Orientierung und eine schützende Hand sucht in einer
Welt, die seinen Eltern den Raum und das Recht zum Leben verweigert. Die
Kinder, das sind Manuel Dias Soeiro, genannt Mané, der als Samuel
Manasseh ben Israel in die Geschichte eingehen soll, und sein erfundener
Nachfahre Viktor Abravanel, Kind jüdischer Überlebender im Wien des 20.
Jahrhunderts. Und doch ist die strikt an zwei Ich-Erzählern aufgebaute
Geschichte weit mehr als die Darstellung von zwei persönlichen
leidvollen Schicksalen.
Über den Trick, die Welt aus den
Augen zweier Kinder bzw. seelisch Kind-Gebliebener zu sehen, schafft es
der österreichische Autor, die zwei Parallelwelten, den religiösen
Vernichtungs-Wahnsinn der Inquisition und den
rassistisch-nationalistischen der Naziherrschaft, so umfassend und
überwältigend darzustellen, dass es streckenweise den Atem nimmt. Lesend
gleitet man in die Ausweglosigkeit und Angst, die der kleine Mané nach
seiner "Rettung" in die geistig und körperlich vergewaltigende
"Zuflucht" des Jesuiteninternats als Dauerzustand durchlebt. Lesend
wütet man mit dem halbstarken Viktor Abravanel gegen die herrschenden
Verhältnisse, erst die staatlichen, dann die nicht minder oppressiven
der linken Kader, bei denen er zum ersten Mal Heimat zu finden glaubte.
Das scheinbar normale Leben nach den
traumatischen Erlebnissen der Verfolgung bleibt hinter dem Schleier aus
erstarrter Einsamkeit, durchdringt den inneren Schutzwall nicht, kann
die tief eingewurzelte Skepsis gegenüber allen äußeren Kriterien nicht
besiegen. Die Eltern des kleinen Mané, versteckte Juden, die heimlich
nach ihrer Tradition leben mußten, die unter den "strengen Verhören" der
Inquisition gelitten haben, verlassen ihre Heimat in Särgen versteckt,
leben auch im sicheren Ausland nicht wirklich auf, obwohl sie es mit
aller Kraft versuchen. Ihr körperliches Sterben wenig später macht
diesen Zustand für Mané nur noch manifest. Die Eltern von Viktor
schweigen über ihre Erlebnisse, bauen ihr Leben getrennt noch einmal
auf, holen nach – nein, das geht nicht – erkämpfen sich den Rest ihres
Lebens in Freiheit (?), beide für sich allein, da ist kein Platz für den
Partner mehr, da ist kein Platz für das Kind.
Der Vordenker und Kämpfer für die
Rechte der Juden, Manasseh ben Israel, bleibt bei Menasse ein
staunender, fremdbestimmter und getriebener Junge, der bei all dem, was
er schafft, und was ihm Platz in den Enzyklopädien sichert, die tiefe
Unsicherheit seiner Kindertage mitschleppt, die Welt als ständiges
Provisorium ertragend. Demgegenüber ist Viktor zum Ankläger geworden,
wütend und analytisch bis zur Selbstgerechtigkeit. Was sie verbindet,
ist die Aura des Suchenden, des Verlorenen, des um sein Leben Ringenden.
Das ist nicht versöhnlich abzurunden, das geht einfach nur irgendwann zu
Ende. |