|
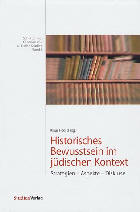
Klaus Hödl (Hrsg.)
Historisches Bewusstsein im jüdischen Kontext
Strategien - Aspekte - Diskurse
Schriften des Centrums für Jüdische Studien Band 6
Studienverlag Innsbruck 2004
Euro 30,00
Bestellen?
Juden gelten als das Volk der Erinnerung. Die Aufforderung,
sich zu erinnern, ist bereits in der Bibel häufig formuliert. Ein
modernes historisches Bewusstsein bei Juden entwickelte sich allerdings
erst im frühen 19. Jahrhundert - und damit später als bei Nichtjuden.
In der vorliegenden Publikation werden verschiedene Formen und
Auswirkungen historischen Denkens bei Juden behandelt. Der Fokus wird
dabei vordringlich auf dessen identitäre Implikationen gerichtet.
Mit Beiträgen von:
Wolfram Drews, Andreas Brämer, Iveta Cermanova, Michaela Wirtz, Gabriele
von Glasenapp, Klaus Hödl, Ulrich Wyrwa, Marcus Pyka, Anke Hillbrenner,
Gerald Lamprecht, Jens Hoppe , Daniel Weidner , Patrick Krassnitzer,
Esther
Kilchmann, Stefan Krankenhagen, Peter Honigmann, Bettina von Jagow, Andrea
Brill, Annette Vowinckel |
Der Held als Schwächling?
oder: Ein gemischter Charakter
Zur "biographischen Methode" in der
Geschichte der Juden von Heinrich Graetz
Von Marcus Pyka
Die Geschichte sei die größte Dichterin, heißt es bei
Plutarch. Derjenige, der sich ihrer Vorlagen zu bedienen weiß, verfügt
also über packendes Material. Dies um so mehr, wenn es dem Autor
gelingt, die längst verblichenen Gestalten der Historie wieder zum Leben
zu erwecken. Nach Meinung nicht weniger seiner Zeitgenossen war dem
Historiker Heinrich Graetz diese Gabe zu eigen. So hieß es etwa:
"Er war unter Wunder und Plagen aus Ägypten gezogen, er
hatte an den Strömen Babels geweint, mit den Sklaven des Römers, mit den
Helden Judäas, im Triumphzuge des Titus Ketten getragen, die Martyrien
aller Länder mitgelitten, die Metzeleien und Ausschlachtungen der
Kreuzzüge und des schwarzen Todes erbleichend und erhebend
ansehen müssen, mitgejagt in allen Verfolgungen, ein theilnehmender Zeuge
aller Austreibungen, der aber auch aus den Katastrophen des Alterthums,
aus den Holzstößen des Mittelalters und aus den Blutbädern der Neuzeit,
wie sie Bogdan Chmielnicky kosakischen Angedenkens angerichtet hat, das
Leben seines Volkes unzerstörbar gleich dem Phönix aus tausend Toden
neuverjüngt hervorgehen sah. Er hatte aber auch mit Mose gedonnert, mit
König David psalmodirt, mit Philo gegrübelt, mit Jehuda Halewi
geschwärmt, mit Spinoza sich ins All versenkt, mit Heine gegeißelt und
unter Thränen gelacht, überall in der Verschiedenheit die Einheit, in
der Buntheit der Erscheinungen dasgeheimnißvoll wirkende große Gesetz
erlauschend und erahnend (1)."
Es war David Kaufmann, der diese beinahe schon
klassische Beschreibung des Stils seines einstigen Lehrers gab. Dieser
Stil war auch den Zeitgenossen aufgefallen, wobei sich hier bereits Lob
und Tadel die Waage hielten. Während die einen die flüssige Lesbarkeit
hervorhoben (gerade dies ist ja etwas, das man Graetzens Vorgänger Isaak
Markus Jost nun gerade nicht attestieren konnte), geißelten die anderen
die Effekthascherei (2). Freilich handelte es
sich hierbei nur um einen Nebenkriegsschauplatz der zahlreichen, oftmals
ebenso wissenschaftlich wie religionspolitisch und eben auch persönlich
motivierten Auseinandersetzungen in jener sehr kleinen république
des lettres, wie sie die Wissenschaft des Judentums jener Zeit
darstellte.
Doch ungeachtet der Frage, aus welcher Perspektive sich
jemand über Graetzens Geschichtsschreibung äußerte, als direkter
Generationsgenosse, als Glied der Schülergeneration(en) oder als
Historiker eben dieser Geschichtsschreibung: immer wieder ist auf die
Darstellung der Personen in besonderem Maße hingewiesen worden,
bisweilen sogar dahingehend, daß man - wie etwa Reuven Michael - von
einer "biographischen Methode" bei Graetz gesprochen hat (3).
Sinnfällige Unterstützung fand diese Deutung gerade durch die Einleitung
zum ersten erschienenen Band der Geschichte der Juden, dem vierten des
Gesamtwerkes von 1853, in dem Graetz die jüdische Geschichte als
beeindruckende Doppelfigur skizziert, die etwa den kraftvollen Holz
schnitten eines Gustave Dore durchaus nicht nachstand:
Auf "der einen Seite das geknechtete Juda mit dem
Wanderstabe in der Hand, dem Pilgerbündel auf dem Rücken, mit
verdüsterten, zum Himmel gerichteten Zügen, umgeben von Kerkerwänden,
Marterwerkzeugen und dem glühenden Eisen der Brandmarkung; auf der
anderen Seite dieselbe Figur mit dem Ernste des Denkers auf der lichten
Stirn, mit der Forschermiene in den verklärten Gesichtszügen, in einer
Studierstube, gefüllt mit einer Riesenbibliothek in allen Sprachen der
Menschen und über alle Zweige des göttlichen und menschlichen Wissens" (4).
In der zweiten Auflage von 1866 charakterisierte er
dieses Bild zusätzlich in der zusammenfassenden Allegorie einer
"Knechtsgestalt mit Denkerstolz" (5). Und wie
der eingangs zitierte Ein druck von Kaufmann belegt, waren es oftmals
die großen und kleinen Beschreibungen von Personen, die 'den Graetz' für
die einen zu einer fesselnden Lektüre machten - und für andere zu einem
zusammenhangslosen Sammelsurium. Abraham Geiger brachte diese Kritik in
einer berühmt gewordenen Formulierung auf den Punkt, als er schrieb, daß
"das Buch [... ] Geschichten [enthalte], die lose verbunden sind, aber
keine Geschichte" (6).
Hier soll nun das Geschichtswerk auf ebendiese Frage hin
untersucht werden. Dabei geht es freilich nicht um die Frage nach
'falscher' oder 'wahrer' Umsetzung von 'Fakten' - für derlei 'Fußnoten'
zu Graetz wären wohl die jeweiligen Fachhistoriker ohnehin kompetenter.
Vielmehr soll Graetzens Stil, die Art seiner Präsentation des
historischen Materials analysiert und gefragt werden, was dies für die
Interpretation seines Gesamtwerkes bedeutet.
Als Beispiel mag ein besonders anschaulicher Fall aus
dem IX. Band der
Geschichte der Juden (1866) dienen, ebenjenem Band, über den Geiger
das oben erwähnte Verdikt der "Geschichten" gefällt hatte. Hier
behandelt Graetz den Zeitraum
Von der Verbannung der Juden aus Spanien und Portugal (1494) bis zur
dauernden Ansiedelung der Marranen in Holland (1618). Dieser bietet
insofern ein besonders gutes Anschauungsmaterial, da Graetz gleichsam
die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen jüdischer Geschichte auf engstem
Räume zeigen kann: Es ist die Blütezeit der Inquisition, die Epoche der
Marranen-Verfolgungen auf der iberischen Halbinsel, die der
Talmudverbrennungen und Judenverfolgungen in Venedig und im Kirchenstaat
- jenes Zeitalter, in dem Religion, die 'rechte' zumal, in einem Maße
zum Politikum wurde, wie es Europa wenigstens seit den
Ketzerverfolgungen und den Kreuzzügen nicht mehr erlebt hatte. Zugleich
war es aber auch diese Epoche, die Figuren wie Salomon Molcho, David
Reubeni und Salomon Aschkenasi hervorbrachte - Abenteurergestalten, die
während ihrer (erzwungenen) Wanderschaft durchaus zu fürstlicher
Stellung und einigem Einfluß aufsteigen konnten.
Die wohl glänzendste aller dieser Erscheinungen war aber
wohl João Miguez, bekannter unter dem im
Osmanischen Reich angenommenen hebräischen Namen Josef Nasi (7).
Wohl um 1514 in Portugal geboren, entstammte er einem Seitenzweig der
marranischen Familie Mendes, welche eines der größten internationalen
Handelshäuser führte. Er verließ seine Heimat in Richtung spanische
Niederlande, von wo er den ständig drohenden Repressalien christlicher
Herrscher entfloh und über Venedig und Ferrara nach Konstantinopel
gelangte. Dort erst bekannte er sich öffentlich zum Judentum, heiratete
seine Cousine Reyna - gegen alle Widerstände ihrer Mutter, seiner Tante
Dona Gracia/Beatriz de Luna, der
grande dame der Familie Mendes.
Don Josef gelang es, als Vertrauter des Prinzen Selim zu
großem Einfluß am osmanischen Hof aufzusteigen, was sich nach Selims
Thronbesteigung in einer glänzenden Rangerhöhung auswirkte - 1566 wurde
er zum Herzog von Naxos ernannt. Als er fünf Jahre später als treibende
Kraft die erfolgreiche Eroberung Zyperns für die Osmanen durchsetzte,
stand er auf dem Höhepunkt seiner Macht, er galt als eine der führenden
Persönlichkeiten auf den diplomatischen Parketts seiner Zeit. Zu den
zahlreichen Unternehmungen politischer, mäzenatischer und
philanthropischer Art, die ihm und seiner Familie zugeschrieben werden,
ist ins besondere das Projekt einer jüdischen Siedlung im galiläischen
Tiberias zu nennen, welche sich jedoch nicht sonderlich lange halten
konnte (8).1579 starb Don Joseph Nasi.
Ungeachtet des Aufruhrs, den Persönlichkeiten wie Nasi
zu Lebzeiten unter ihren Zeitgenossen provozierten, blieb ihr direktes
Nachleben sehr beschränkt, was im Falle Molchos und Reubenis sicherlich
mit ihrem grandiosen Scheitern erklärt werden kann. Doch selbst über
Josef Nasi wird in erzählenden jüdischen Quellen nur wenig überliefert,
die meisten Informationen stammen aus der Responsenliteratur sowie den
(freilich tendenziösen) Berichten der abendländischen diplomatischen
Vertreter bei der Hohen Pforte. Weitaus bekannter geblieben sind
hingegen jene beiden Zerrbilder des elisabethanischen Theaters, denen
Don Josef Nasi direkt und indirekt zur Vorlage für ihre judenfeindliche
Polemik gedient hatte - Barrabas in Marlowes The Jew of Malta
(1590) und Shylock in Shakespeares
The Merchant of Venice (1594) (9).
Auf der Schauspielbühne präsent blieb aber eben nur die
Karikatur unter anderem Namen;
insofern kann man die 'Wiederentdeckung' von Don Josef Nasi auf das 19.
Jahrhundert zurückführen, freilich weniger auf die sich gerade erst
entwickelnde Wissenschaft des Judentums, sondern vielmehr auf den
Patriarchen der Osmanistik, Josef von Hammer (1774-1856, seit 1835
Freiherr von Hammer-Purgstall). In dessen monumentaler
Geschichte des Osmanischen Reiches fand sich erstmals eine
ausführlichere Beschreibung von Don Josef Nasis Wirken (10).
In dessen Gefolge erschienen eine Reihe von monographischen, im Ton eher
populären Aufsätzen, zu deren Autoren auch Graetz zählt (11).
In seiner Abhandlung stellt Graetz Don Josef als unabhängigen "Helden"
dar, der überdies selbst in Krisensituationen deutlich als leuchtendes
Vorbild präsentiert wird (12). Dabei handelte
es sich um den klassischen Fall einer Biographie gemäß dem methodischen
Vorbild Leopold von Rankes (13).
Zehn Jahre später beschäftigte sich Graetz für sein
opus magnum erneut intensiver mit dem 16. Jahrhundert (14).
Auch in der Geschichte der Juden spielt Josef Nasi eine
bedeutende Rolle, ob schon in einem anderen Rahmen. Tatsächlich hat
diese Persönlichkeit für Graetz einen solchen außerordentlichen Rang in
ihrem Zeitalter, daß ihr ein ganzes Kapitel gewidmet ist, eine durchaus
nicht selbstverständliche Ehrung (15). Gewiß,
Joseph Nasi, "von Gottes Gnaden Herzog des ägäischen Meeres, Herr von
Andros" (16), wie er sich selbst einmal
nannte, hatte einen Rang erreicht, der in der jüdischen Geschichte nicht
oft zu finden ist und insofern zweifellos einiges Interesse
rechtfertigen konnte. Doch beschreibt Graetz in diesem Kapitel mehr als
ein Jahrhundert jüdischen Lebens im Osmanischen Reich - Josef Nasi
erlebte hiervon jedoch lediglich 25 Jahre am Bosporus, nachdem er ja
zuvor in Portugal, den Niederlanden und Oberitalien gelebt hatte; und so
herausragend auch seine Stellung gewesen sein mag, er war in Graetzens
eigener Darstellung weit davon entfernt, dieses Zeitalter maßgeblich zu
prägen (anders als etwa Maimonides oder Moses Mendelssohn dies nach
Auffassung der damaligen Geschichtsschreibung getan haben). - Angesichts
dieser Gewichtung stellt sich zunächst die Frage, in wieweit es
Alternativen gegeben hätte, die zweifellos wichtige Epoche jüdischen
Wohlergehens im Osmanischen Reich zu charakterisieren, oder ob überhaupt
eine solche herausgerückte Einzelperson notwendig gewesen ist.
Einer gängigen Auffassung zufolge handelt es sich bei
Graetzens
Geschichte der Juden um eine "Leidens- und Gelehrtengeschichte" (17).
Diesem Bild entspricht ja durchaus die von Graetz selbst in der
Einleitung zu Band IV gegebene und bereits zitierte Charakterisierung
jüdischer Geschichte als einer "Knechtsgestalt mit Denkerstolz". Demnach
wäre zunächst nach Märtyrern oder Gelehrten zu suchen. Angesichts der
wohlhabenden und weitgehend gesicherten Stellung der Juden im
Osmanischen Reich entfallen die 'Leiden' als Möglichkeit weitgehend. Die
theologische Basis für ihre vorteilhafte Lage boten die grundsätzlich
Juden duldenden Bestimmungen des Koran (18).
Darauf aufbauend genossen sie entsprechend der Binnenorganisation des
Reiches nach ethnischen und religiösen Gruppen als eigenständige
millet ein großes Maß an Gemeindeautonomie. Darüber hinaus erfreuten
sich die Osmanischen Juden, die im internationalen Handel tätig waren,
unter Süleyman und seinen direkten Nachkommen eines beträchtlichen
Wohlstandes, da die von den Sultanen mit den christlichen Mächten
abgeschlossenen Kapitulationen diesen internationalen Handel
beträchtlich erleichterten (19).
Für eine 'Gelehrtengeschichte' kämen hingegen gleich
mehrere bedeutsame Kandidaten in Frage. Zu denken wäre etwa an Isaak
Luria und Hayim Vital Calabrese, die Begründer der (lurianischen)
Kabbala. Für Graetz freilich stellte sich diese Errungenschaft als der
Anbeginn von etwas dar, das er "ein eigentümliches, dummgläubiges
Mittelalter" nannte, welches im Judentum gerade erst begonnen habe, "als
sich in der europäischen Welt nur noch die letzte Spur des nächtlichen
Grauens zeigte" (20). Zwar diagnostizierte
Graetz ein Bedürfnis nach Innerlichkeit, worin er eine der Quellen für
jene spirituelle Bewegung sah; doch waren für ihn die konkreten
Ausformungen der Kabbala und ihre Lehren nichts weiter als Aberglaube
und Horte der Unsittlichkeit. Der "Schimmelüberzug" (S. 402), mit dem
die Kabbala das Judentum bedeckt habe, sei bis zur Gegenwart noch nicht
gänzlich entfernt worden.
Ein wenig näher als Luria und der Kabbala hätte Graetz
einem anderen wichtigen Gelehrten stehen können, zumindest vorderhand.
Denn im galiläischen Safet wirkte im 16. Jahrhundert neben Luria und
Vital auch Josef Karo als Rabbiner, der Autor des
Shulkhan Aruch, des bis heute maßgeblichen Rechts-Kodex', und auch
Graetz verweigert diesem Werk nicht das Prädikat "epochemachend" (S.
383). Allein er spricht ihm zugleich jedwede Originalität ab, und
ungeachtet einzelner Lehren, die den Beifall des Historikers finden, ist
ihm das Werk ein "Meer
von kasuistischen Einzelheiten und Äußerlichkeiten" (S. 386). Zu dieser
abfälligen Haltung gegenüber einem der zentralen Kompendien der
jüdischen Religion war Graetz bereits in seiner Jugend gekommen, als er
als eine Art Famulus im Hause Samson Rafael Hirschs in Oldenburg
studierte. Graetz trennte sich im Unfrieden von dem nachmaligen
Begründer der Neo-Orthodoxie, wobei einer der ausschlaggebenden
Streitpunkte die für Graetz übergroße Traditionsgläubigkeit Hirschs
gewesen war, die der junge Mann in seinem Tagebuch als "Shulkhan
Aruch-ianismus" (21) geißelte. Für Graetz
bedeutete dieses Festhalten an überkommenen Traditionen und die
Hinwendung zu den ehrwürdigen Altvorderen eine Verkrustung und
Versteinerung, die seiner Meinung nach dem Judentum wesensfremd war.
Entsprechend betrachtete er Karo als einen "abgesagten Feind des
Nachdenkens über religiöse Fragen", der "das geringste Bezweifeln einer
im Talmud vorkommenden Äußerung als schwere Ketzerei" (S. 386) ansah;
dessen Haltung jedoch war für Graetz "ein ganz anderes Judentum als das,
welches am Sinai offenbart, von den Propheten verkündet und selbst von
Maimuni gelehrt" (S. 386) worden war.
Nichtsdesto weniger muß der Historiker einräumen, daß
Karo außerordentlich prägend auf seine Zeit gewirkt hat bzw. seinerseits
nur Ausdruck des theologischen Zeitgeistes gewesen ist. (22)
Dieses türkischjüdische 16. Jahrhundert sei insgesamt ein sehr mediokres
Jahrhundert gewesen, was die intellektuellen Errungenschaften angehe:
"Nicht ein einziger der damals lebenden Führer der
Gemeinden ragte über das Maß eines Alltagsmenschen hinaus. Die Rabbinen
und Prediger waren grundgelehrt in ihrem Fache, wandelten aber durchweg
in ausgefahrenen Gleisen, ohne auch nur auf ihrem eigenen Gebiet eine
neue Seite hervorzukehren oder eine Leistung besonderer Art zu
hinterlassen." (S.383)
Dabei habe das Wohlergehen mit der geistigen Behäbigkeit
und der Leichtgläubigkeit in unguter Beziehung gestanden (23).
Eben hierfür aber sei Don Josef Nasi repräsentativ gewesen. Ungeachtet
seines wohltätigen Wirkens habe jener letztlich "nichts Wesentliches und
Dauerndes für das Judentum getan". Der Grund hierfür habe "in seiner
geringen Kenntnis des jüdischen Schrifttums und in seinem Mangel an
wissenschaftlichem Sinn" gelegen. Und was immer der so Gescholtene an
philanthropischen und mäzenatischen Tätigkeiten geleistet haben mag, der
Historiker disqualifiziert es als ephemer und als Äußerlichkeit (24).
So fällt letztlich Graetzens Gesamtresümee verheerend aus:
"Der Glanz, der von dem jüdischen Herzog von Naxos und
anderen einflußreichen Juden am türkischen Hofe auf ihre
morgenländischen Glaubensgenossen fiel, [glich,] genau betrachtet, einem
Irrlichte, das einen Sumpf mit hellem Schimmer flimmern macht."
Ein "entschiedener Rückfall ins Heidentum" sei das
Ergebnis dieser "Versumpfung" (alle drei Zitate S. 405) gewesen. Sollte
aus der einstmals so heldischen Gestalt des Herzogs in raschem Schritte
ein Schurke geworden sein? Hier gilt es, sich der genauen Darstellung
bei Graetz zu entsinnen. Denn der Herzog von Naxos steht zwar durchaus
im Mittelpunkt dieses Kapitels, jedoch kaum als autonom handelnder
Charakter. Vielmehr dient er als Repräsentant der ihm zugewiesenen
Epoche. Damit unterscheidet sich dieses Kapitel in der Geschichte
entscheidend von jener früheren biographischen Skizze, die noch einen
strahlenden und unabhängigen Helden präsentiert hatte. In dem großen
Geschichtswerk ist Don Joseph eben kein überragender Gestalter, der
seiner Zeit seinen Stempel aufdrückt. Vielmehr verkörpert er, wie so
viele andere der Protagonisten im Graetzschen Geschichtswerk, die
jeweiligen Zeittendenzen und Eigenschaften. An diesem Punkt muß daher
auch das übliche Bild der 'Schurken und Helden' zumindest relativiert
werden. Denn Graetz kommt bei den meisten seiner handelnden Figuren ohne
eine allzu grobe Schwarz-weiß-Malerei aus (25).
Wenngleich er sich gerne einer sinnlichen oder auch einer drastischen
Ausdrucks weise bedient, einer überaus bildreichen zumal, so setzen sich
seine Figuren doch aus verschiedenen solcher Eigenschaften zusammen, die
er nicht selten ziemlich unterschiedlich wertet. Im Falle des Herzogs
von Naxos etwa reicht das Spektrum der Beschreibungen von einem
einnehmendem Äußeren, Erfindungs- und Kenntnisreichtum sowie Klugheit
(jeweils S. 359) über einen praktischen Geist (S. 380) bis hin zu
Wankelmütigkeit, Stolz und Hochmut (S. 382). Damit zeigt Graetz ihn als
einen 'gemischten Charakter'.
Diese Art eines 'gemischten Charakters' war eine
Neuerung des seinerzeit neu entstehen den Genres Historischer Roman, die
ihren fulminanten Auftritt in der Weltliteratur in Gestalt Edward
Waverleys hatte, des Protagonisten des Romans Waverley or 'Tis Sixty
Years Since (1814) von Sir Walter Scott (26).
Graetz, der sich als Kind leidenschaftlich und wahllos durch
Ritterromane und Weltliteratur gelesen hatte, war auch ein begeisterter
Leser zumindest von Ivanhoe sowie mancher der historischen Dramen Victor
Hugos gewesen (27). Auch für die Geschichte
der Juden läßt sich feststellen, daß eine signifikante Nähe von
Graetzens Historiographie und den anderen geschichtsorientierten
Erzählformen seiner Zeit - Historischer Roman und Grand Opera -
auffällig ist. Sie zeigen jeweils das Individuum vor dem Hintergrund des
historischen Geschehens, welches doch schicksalsmächtig auf das
Individuum zurückwirkt (28). Graetz folgt
dieser Tradition durchaus und läßt in der Tat Scharen von Figuren die
Szenerie bevölkern, bisweilen mit stark differenzierten Eigenschaften.
Derlei Charakterzeichnungen allein machen freilich noch
keinen biographischen Ansatz. Denn was Graetzens Protagonisten nahezu
durchgehend fehlt, ist die Kohärenz ihrer verschiedenen Eigenschaften,
weshalb sie nicht als Individuen anzusehen sind - sie bleiben in den
verschiedenen Situationen, in denen sie gezeigt werden, jeweils nur
Vertreter dieser einen Eigenschaft, in der sie gerade auftreten. Daraus
können sich dann durchaus auch Widersprüche ergeben, wie eben bei Josef
Nasi, dessen 'praktischer Sinn' ihn nicht davon abgehalten habe,
unsinnig sich im Weiten verlierende Pläne zu schmieden (S. 381). Graetz
bemüht sich nicht darum, seine Figuren durch 'Verstehen' im Droysenschen
Sinne zu erfassen und damit zu beleben. Aus dieser Perspektive blieben
die allermeisten seiner
dramatis personae bloße Typen, wenngleich in vielfarbiger und
evokativer Kostümierung.
Wenn sich dennoch die Graetzsche Geschichte nicht
als hölzernes Bauerntheater in prunkvoller Ausstaffierung, sondern
vielmehr als ein packendes "vieltausendjähriges Heldendrama" (29)
liest, dann hängt dies mit der Funktion ebendieser Protagonisten
zusammen: Sie dienen dem Historiker als Repräsentanten ihrer Epoche, in
denen bestimmte kollektive oder zeittypische Eigenschaften wie in einem
Brennglas zusammengefaßt sind; dabei können - wie eben im Falle des
Herzogs von Naxos - diese Eigenschaften durchaus der entsprechenden
Charakterisierung in Graetzens monographischen Studien widersprechen.
Der eigentliche Protagonist seiner Geschichtserzählung, wie sie in der
Geschichte der Juden
manifest wird, ist vielmehr die Gesamtheit des jüdischen Volkes. Dieses
Volk ist - gleichsam in Analogie zu Rankes Mächten - die historische
Individualität in Graetzens Geschichtsbild, eine Individualität, die
sich tatsächlich allmählich weiterentwickelt (und nicht bloß
zusammensetzt) und in diesem Prozeß in einzelnen, repräsentierenden
Gestalten porträtiert wird.
Diese Entwicklungsmöglichkeit seines eigentlichen
Protagonisten, dessen bedingte Autonomie bei gleichzeitiger
Eingebundenheit in die historischen Prozesse läßt sich wiederum gut am
Beispiel der türkischen Juden des 16. Jahrhunderts veranschaulichen.
Denn aus der Perspektive eines Historikers des 19. Jahrhunderts hatten
sie es gleich mit zwei üblen Gesellen der Weltgeschichte zu tun, den
(nachklassischen) Griechen - die in der Geschichtsschreibung
vorzugsweise die Rolle des Schurken zugewiesen bekamen (30)
- und den Türken, die hier avant la lettre gleichsam zum Kranken
Mann am Bosporus gestempelt wurden (31). In
seiner Darstellung des Osmanischen Reiches bedient sich Graetz des
ganzen Katalogs 'orientalistischer' Klischeevorstellungen (32),
wobei er die Symptome des Niederganges selbst für die Verhältnisse der
europäischen Historiographie bemerkenswert früh erkennen will, nämlich
bereits unter Süleyman dem Prächtigen, wenn das Haupt der Gemeinde von
Salonika, Mose Almosnino, das Leben in der Hauptstadt beschreibt,
"mit seinen Gegensätzen von glühender Wärme und
erstarrender Kälte, erstaunlichem Reichtum und abschreckender Armut,
verweichlichendem Luxus und strenger Enthaltsamkeit, verschwenderischer
Mildtätigkeit und herzlosem Geize, übertriebener Frömmigkeit und
gottvergessener Lauheit, die sprungweise, ohne sanfte Übergänge einander
folgten." (33)
Inmitten dieses Hortes der Sinnlichkeit und der Dekadenz
lebten also die Marranen, die den Scheiterhaufen der Inquisition
entkommen waren, und sie erfreuten sich einer ausgesprochen günstigen
Stellung. Jedoch ließen sie sich von dem Wohlstand und der Indolenz
anstecken; die Folge war langsam einreißende Sittenlosigkeit, die bald
schon zur Selbstverständlichkeit wurde. Als Repräsentantin für diese
Endphase zeigt Graetz die Favoritin der Gemahlin des Sultans Murad III.,
Esther Kira, die aus dem Harem heraus an der Leitung der Staatsgeschäfte
teil hatte (34): "Sie bereicherte sich
natürlich durch ihre stille Macht, wie jedermann in der Türkei, der, wie
schwach oder stark auch immer, in die Speichen der Staatsräderwerkes
eingriff" (S. 408). Während er aber die Korruptheit dieser jüdischen
Favoritin exemplarisch und ausführlich beschreibt, finden ihre
philanthropischen Werke nur in einem einzigen Satz Erwähnung; doch sind
es eben diese, die in den jüdischen Quellen (wenngleich nicht in den
venezianischen Relationen) weit mehr überliefert werden, wie der
Historiker im Anhang berichtet (Note 8 II, S. 548ff.).
Mit dem Niedergang des Osmanischen Reiches kam nach
Graetz auch für die dort leben den Juden der Niedergang: "Der Glanz der
türkischen Juden erlosch wie ein Meteor und verwandelte sich auch da in
dunkle Nacht, die nur noch von Zeit zu Zeit verzerrte Traumbilder zum
Vorschein brachte" (S. 409). Diese "Traumbilder" konnten noch viel
weniger vollwertige Charaktere mit einer individuellen biographischen
Darstellung sein als ihre Vorgänger zu den Glanzzeiten. Doch war dies
auch gar nicht nötig, da sich Graetzens Geschichte der Juden, eigentlich
eher: des jüdischen Volkes, ohnehin ungeachtet der Einzelschicksale
weiterentwickelte und sich bereits zu der Zeit, als die Esther Kira mit
ihren Söhnen von aufgebrachten Sipahis ermordet wurde, der "Mittelpunkt
[...] nach einem ändern Schauplatze verschoben" hatte (S.409).
Tatsächlich entspricht diese Methode der Repräsentanz
des Ganzen durch einzelne Figuren durchaus jenem zu Beginn zitierten
allegorischen Bild, das Graetz von der jüdischen Geschichte entworfen
hatte. Und konsequenterweise spricht er im weiteren Verlauf jener
Einleitung beständig vom jüdischen Volk und seinem Erleben, seinen
Hervorbringungen, der es anleitenden Idee. Diesem einigenden Narrativ
sucht Graetz die Geschichte der Juden unter zuordnen. Demgegenüber
werden Gegenspieler oder Verbündete, werden Schurken und Hel den in
seinem Geschichtswerk letztlich rasch zu ephemeren Belanglosigkeiten.
Anmerkungen:
Für Kritik und Anregungen danke ich herzlich Alexander Schunka, M.A.
(1) D[avid] Kaufmann, H. Graetz, in: Allgemeine Zeitung
des Judenthums 55 (1891),450.
(2) Vgl. etwa M. Wiener, Zur Würdigung des Verfahrens
von Grätz bei der Bearbeitung seiner Geschichte der Juden, in: Ben
Chananja (1863), 374.
(3) Reuven Michael, Vorwort, in: Heinrich Graetz,
Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegen wart, Bd.
I, Darmstadt 1998 [Nachdruck], XI.
(4) Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Bd. IV, l. Aufl., Leipzig 1853, l
f.
(5) Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten
bis auf die Gegenwart, Bd. IV, 2. Aufl., Leipzig 1866, l (so auch in
allen folgenden Auflagen).
(6) Brief Abraham Geigers an M.R. vom 7. Mai 1866.Aus
einem Briefwechsel, in: Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben
5 (1867), 146.
(7) Aus der Fülle der Literatur zu Josef Nasi seien hier
nur genannt: Salo Wittmayer Baron, A social and religious
history ofthe Jews, Bd. 18, New York, Philadelphia 1983,45-119; Paul
Grunebaum-Ballin: Joseph Naci, duc de Naxos, Paris, La Haye, 1968; Cecii
Roth, The house of Nasi, 2 Bände., Philadelphia 1948; Herman Prins
Salomon u. Aron di Leone Leoni, Mendes, Benveniste, de Luna, Micas,
Nasci: the state of the art (1532-1558), in: The Jewish Quarterly Review
88 (1998), 135-211.
(8) Diese Zuschreibung beruht vermutlich auf dem Bericht
in Joseph ha-Kohens Emek ha-Bachah; doch gingen die se Pläne vielmehr
von Joseph Nasis Tante und Schwiegermutter Dona Gracia Mendes aus. Vgl.
Baron, History, Bd. 18, wie Anm. 7,109-118.
(9) Vgl. Baron, History, Bd. 18, wie Anm. 7, 105 sowie
483, Anmerkung 63; Dietrich Schwanitz, Das Shylock-Syndrom, oder Die
Dramaturgie der Barbarei, Frankfurt am Main 1997,81-86; James Shapiro,
Shakespeare and the Jews, New York, Chichester 1996. - Graetz selbst
erkannte die Verbindung zwischen Don Joseph Nasi und Shylock in seinem
bedeutenden Aufsatz von 1880 noch nicht, er konzentrierte sich allein
auf die (seitdem allgemein akzeptierte) Verknüpfung des Merchant of
Venice mit der Hinrichtung von Elisabeths I. Leibarzt Rodrigo Lopez
1594; vgl. Heinrich Graetz, Shylock in der Sage, im Drama und in der
Geschichte, in: Monatsschrift für Wissenschaft und Judenthum 29
(1880),337-354 und 385-403.
(10) Dies war selbstverständlich in der Perspektive
einer allgemeinen Geschichte des Osmanischen Reiches eingebettet und
insofern über mehrere Bände passim verstreut. Vgl. u.a. Joseph von
Hammer: Geschichte des Osmanischen Reiches, Bd. 3, Pest 1828,364f.,
514,563ff. u. ö. - Eine eingehende Untersuchung des Hammerschen
Geschichtswerkes ist immer noch ein Desiderat der
Wissenschafts-Forschung; einführend vgl. Klaus Kreiser, Clio's poor
relation. Betrachtungen zur osmanischen Historiographie von
Hammer-Purgstall bis Stanford Shaw, in: Gernot Heiss u. Grete
Klingenstein, Hg., Das Osmanische Reich und Europa 1683 bis 1789:
Konflikt, Entspannung und Austausch, Wien 1983,24-43.
(11) Vgl. Selig Cassel s.v. Juden (Geschichte), in:
Johannes Samuel Ersch u. Johann Gottfried Gruber, Hg., Allgemeine
Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von
genannten Schriftstellern bearbeitet, II. Reihe, Bd. 27, Leipzig
1850,1-238; Eljakim Carmoly, Don Joseph, duc de Naxos, o.0.1855;
Heinrich Graetz, Don Joseph, Herzog von Naxos, Graf von Andres und Donna
Gracia Nasi. Eine Biographie, in: Jahrbuch für Israeliten
5617/1856/57,1-39, und Moritz Abraham Levy: Don Joseph Nasi, Herzog von
Naxos, seine Familie und zwei jüdische Diplomaten seiner Zeit. Eine
Biographie nach neuen Quellen dargestellt, Breslau 1859.
(12) Ungeachtet des populären, oftmals rhethorischen
Stil mit einer deutlich starken Behandlung von Liebes- und
Familienbeziehungen, ist der wissenschaftliche Gehalt dieses Aufsatzes
unbezweifelbar, wie dies etwa in den zahl losen Fußnoten deutlich wird.
Vgl. Graetz, Don Joseph, wie Anm. 11, Zitat l.
(13) Zu Rankes episch-dokumentarischer Biographik vgl.
Jürgen Oelkers: Biographik. Überlegungen zu einer un schuldigen Gattung,
in: Neue politische Literatur 19 (1974), 296-309, hier 300ff., und Olaf
Hähner, Historische Biographik. Die Entwicklung einer
geschichtswissenschaftlichen Darstellungsform von der Antike bis ins 20.
Jahr hundert, Frankfurt/Main u.a. 1999,122-134.
(14) Zu den Vorarbeiten gehört freilich auch ein
Aufsatz über Moses Almosnino, einen bedeutenden Gelehrten aus Sa lonica
und Zeitzeugen Don Josefs. Vgl. Heinrich Graetz, Mose Almosnino. Eine
Skizze, in; Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums
13(1864), 23-36 und 57-67.
(15) Dies legt ein Vergleich mit anderen großen
Gesamtdarstellungen jüdischer Geschichte nahe: Simon Dubnow behandelt
zwar den Herzog von Naxos in einem eigenen Paragraphen (§4: "Joseph
Nassi und die jüdischen Diplomaten"), aber lediglich als vergleichsweise
kurzes Unterkapitel zu "Das Wiedererwachen des östlichen Zentrums (die
Türkei und Palästina)"; vgl. Simon Dubnow, Weltgeschichte des jüdischen
Volkes. Von seinen Uranfängen bis zur Gegenwart, Bd. 7, Berlin
1927,35-46; und auch Salo Baron charakterisiert diese Epoche insgesamt
als "Turkey's Golden Age", worin Don Joseph Nasi lediglich einen
kleineren Teil ausmacht, vgl. Baron, History, Bd. 18, wie Anm.7, S.
84-118.
(16) "Josephus Naci Dei Gratia Dux Aegei Pelagi Andri".
Zitiert nach Grunebaum-Ballin, Joseph Naci, wie Anm. 7,96.
(17) Vgl. etwa Michael Brenner, Von einer jüdischen
Geschichte zu vielen jüdischen Geschichten, in: Ders. u. David N. Myers,
Hg., Jüdische Geschichtsschreibung heute. Themen, Positionen,
Kontroversen, München 2002,17-35, hier 20. - Diese Sichtweise geht
vermutlich auf einen Aufsatz Salo Barons zurück; vgl. Graetzens
Geschichtsschreibung. Eine methodologische Untersuchung, in:
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 62 (1918),
11.
(18) Grundlegend zur religiösen Stellung von Juden in
der islamischen Welt vgl. Baron, History, Bd. 18, wie Anm. 7, S. 1-295,
Mark R. Cohen: Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Ages. 4.
Aufl. Princeton 1996; Bernard Lewis, Die Juden in der islamischen Welt.
Vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, München 1987; Norman
Stillman, The Jews ofArab Lands. A history and source book, Philadelphia
1979,3-110. - Zwar macht Graetz ins besondere in seiner Schrift über
Moses Almosnino auch deutlich, daß selbst hier die Lage der Juden nicht
gänzlich unangefochten war; dennoch stellt er über diese Epoche auch
fest: "jüdische Historiker [fühlen sich] davon angezogen, als sie dabei
nicht die Misere zu erzählen hatten, welche ihre Stammes- und
Religionsgenossen zu er dulden hatten." Graetz, Almosnino, wie Anm.
14,57 u. 64 (Zitat).
(19) Zu Süleyman vgl. den facettenreichen Sammelband
von Gilles Veinstein, Hg., Soliman le Magnifique et son temps, Paris
1992.
(20) Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Bd. 9,4. Aufl., Breslau 1907,
390. - Im folgenden werden die Zitatnachweise aus der Geschichte (der
leichteren Zugänglichkeit halber aus dem Nachdruck Darmstadt 1998)
jeweils im Text gegeben.
(21) Tagebucheintrag l. Mai 1839. Heinrich Graetz,
Tagebuch und Briefe, hrsg. von Reuven Michael, Tübingen 1977, S. 77f.,
Zitat S. 78.
(22) Graetz leistet sich überdies die nach diesen
Feststellungen höchst mokante Bemerkung, daß "durch Karo [... ] das
Judentum diejenige feste Gestalt [erhalten habe], die es bis auf den
heutigen Tag bewahrt" habe (S. 386).
(23) Dies zeigen seine Bemerkungen über die Gläubigkeit
der Zeitgenossen für die Geschichten von Reubeni und Molcho und anderen:
"Die Lage in der Gegenwart machte solche Mären glaublich." (S. 379). -
Vgl. auch: "Die so überaus günstige Lage der Juden in der Türkei während
eines ziemlich langen Zeitraums hatte also keine nachhaltig günstige
Erhebung zur Folge. Sie erzeugte keinen einzigen Kraftgeist, welcher
befruchtende Gedanken für die Zukunft aus sich heraus geholt und den
Mittelmäßigen eine neue Richtung vorgezeichnet hätte" (S. 383).
(24) "Denken und Forschen über Religion und die
Bestimmung des Menschen war nicht Sache des Joseph von Naxos. So viel
Geist er auch hatte, er richtete ihn nicht nach dieser Seite hin,
sondern auf weltliche Dinge; er nahm die Religion des Judentums als
etwas Gegebenes hin, worüber weiter nicht viel zu grübeln sei." (382).
(25) Ausnahmen hiervon sind freilich jene, die
lediglich als Mächte von außen einwirken, wie etwa Philipp II. von
Spanien oder Papst Paul IV.; sobald diese Personen selbst handelnd
eingreifen, gesteht der Historiker ihnen eine differenziertere
Behandlung zu.
(26) Scott selbst hatte diese Art der Rolle
charakterisiert als "a thing never acting but perpetually acted upon".
Walter Scott, Nigel [1822] in: ders., The Waverley novels. Centenary
edition, Bd. 14, Edinburgh 1871, S. 290. - Hierzu vgl. Georg Lucäcs, Der
historische Roman, Neuwied 1965,36-76, und Alexander Weish, The hero
ofthe Waverley novels, New Haven, London 1963,20-41.
(27) Graetz, Tagebuch, wie Anm. 21,8.
(28) Zur Grand Opera als Geschichtserzählung mit einem
schwachen Tenor als 'Helden' im Zentrum vgl. Anselm Gerhardt, Die
Verstädterung der Oper. Paris und das Musiktheater des 19. Jahrhunderts,
Stuttgart, Weimar 1992, hier bes. 93-96.
(29) Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Bd. 11,2. Aufl., Leipzig 1900,
427.
(30) Vgl. auch: "Wurden die Juden in den Provinzen
irgendwo bedrängt, was namentlich von den boshaften Griechen geschah
[...]" (374). - Wohl am anschaulichsten hat Leopold von Ranke dieses
Bild der "Neugriechen" in seiner ganzen Widersprüchlichkeit aus
antikisierender Verherrlichung und 'orientalistischem' Spott
präsentiert; vgl. hier zu seine "Digression über die Neugriechen im
sechszehnten Jahrhundert" in: Die Osmanen und die spanische Monarchie im
sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, 3.Aufl., Berlin 1857, S. 22-30.
(31) Wenngleich die Ursprünge dieser Metaphorik wohl im
17. Jahrhunderts zu suchen sind, so geht die Wortprägung selbst wohl auf
Zar Nikolaus I. zurück. Vgl. Gudrun Krämer, Geschichte Palästinas. Von
der osmanischen Eroberung bis zur Gründung des Staates Israel, München
2002,385, Anm. 4, sowie Alexander Schunka: Der Mann am Bosporus - wie
krank war er wirklich? Der 'Niedergang' des Osmanischen Reiches im
Spiegel der Nasihatname Literatur und die neuere Forschung. In: Arndt
Brendecke u. Wolfgang Burgdorf, Wege in die Frühe Neuzeit, Neuried
2001,42.
(32) Hierzu vgl. Edward Said, Orientalism, 4. Aufl.,
London 1995, sowie Jürgen Osterhammel, Wissen als Macht. Deutungen
interkulturellen Nichtverstehens bei Tzvetan Todorov und Edward Said,
in: Ders.: Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. Studien
zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich, Göttingen
2001,240-265, und James Pasto: Islam's "Strange Secret Sharer".
Orientalism, Judaism, and the Jewish Question, in: Comparative Studies
in Society and History 40 (1998), 437-474.
(33) Graetz, Geschichte, Bd. 9, wie Anm. 20,375. - Es
ist auffällig, wie stark Graetz hier seine eigene Zusammenfassung in dem
älteren Aufsatz über Moses Almosnino verkürzt: Jene war zwar schon von
ähnlicher Tendenz, doch noch nicht dermaßen auf die - klassisch
'orientalistischen' - Imaginationen des Sozialen verkürzt; Graetz nennt
dort noch ausführlich die von Almosnino geschilderten Gegensätze auch
des Wetters und der Naturverhältnisse, so wie den Umstand, daß die
gesamte zweite Hälfte der Schrift dem osmanischen Staatswesen, seiner
Politik und der Architektur seiner Hauptstadt gewidmet ist. Vgl. Graetz,
Almosnino, wie Anm. 14,63.
(34) Zum Hintergrund vgl. immer noch J.H. Mordtmann,
Die jüdische Kira im Serail der Sultane, in: Mitteilungen des Semmars
für orientalische Sprachen zu Berlin, 2. Reihe, 32 (1929), S. 1-38,
sowie Baron, History, Bd. 18, wie Anm. 7,131-134 und 494, Anm. 13.
hagalil.com
28-01-05 |