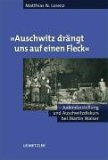
Matthias N. Lorenz,
'Auschwitz drängt uns auf einen Fleck'. Judendarstellung und
Auschwitzdiskurs bei Martin Walser
Metzler Verlag 2005
Euro 49,95
Bestellen? |
Antisemitismus bei Walser:
In Gefühlsgewittern
Matthias N. Lorenz hat Martin Walsers
Werk auf antisemitische Spuren hin durchpflügt - und seine Kritiker stählen
ihren Patriotismus.
Von Micha Brumlik
Frankfurter Rundschau,
08.09.2005
Eine geisteswissenschaftliche Dissertation gehört
üblicherweise nicht eben zu dem Stoff, der die öffentliche Erregung
befördert. Dass dies nun einer umfassenden, in einem angesehenen
wissenschaftlichen Verlag erschienenen Arbeit gelungen ist, kann nicht
lediglich am Thema liegen: Die Judendarstellung und der Auschwitzdiskurs im
Werk Martin Walsers.
Es liegt vielmehr daran, wie der junge Lüneburger
Kulturwissenschaftler Matthias Lorenz sein Thema unter dem Titel Auschwitz
drängt uns auf einen Fleck behandelt. Er hat in seiner von stupender
Gründlichkeit und hermeneutischer Delikatesse zeugenden Arbeit zeigen, nein
beweisen können, dass Martin Walsers literarisches und essayistisches Werk
tatsächlich, und zwar von allem Anfang an, von antisemitischem Ressentiment
durchzogen ist; woran der Umstand nichts ändert, dass dieser jüdischen
Autoren wie Victor Klemperer oder Ruth Klüger mit zum Durchbruch verhelfen
konnte.
Das an Belegstellen und Quellenverweisen reiche, gut
lesbare Werk, das es sich gerade beim Verwenden des Begriffs
"Antisemitismus" alles andere als leicht macht, enthüllt die Persönlichkeit
eines Autors, der seit Beginn seiner Karriere verbissen an der Aufwertung
der deutschen Opfer und, damit verbunden, an der Abwertung und
Vernachlässigung jüdischer Leidenserfahrung arbeitet, eine Tendenz, die
endlich mit einer gewissen Notwendigkeit in den von antisemitischen
Klischees durchzogenen Roman Tod eines Kritikers (2002) mündete.
Wie brisant diese Erkenntnisse sind, erwies sich an dem
ungewöhnlich massiven publizistischen Sperrfeuer, das sie auslösten. Dieter
Borchmeyer, hochmögender und gewandt formulierender Germanist an der
Universität Heidelberg, seit Jahren für seine ebenso erfolg- wie sinnlosen
Versuche bekannt, das Werk Wagners vom Antisemitismus zu befreien,
beschimpfte am 23. August wenig kollegial in der Süddeutschen Zeitung die
Lüneburger Germanistik: Lorenz' Arbeit stelle der "universitären
Institution, die für sie die Verantwortung übernommen hat, kein gutes
Zeugnis aus. Das in Aufbau und Umfang monströse, im Gehalt denunziatorische
Buch argumentiert in weiten Teilen auf wissenschaftlich indiskutable Weise.
Als abschreckendes Beispiel der ideologischen und moralischen Hinrichtung
eines bedeutenden Schriftstellers diene es" - so Borchmeyers pathetischer
Schlussappell - zur Warnung vor einer vermeintlichen Wissenschaft, die
Literatur nicht erhellt und erhält, sondern vernichtet".
Und sehen betroffen...
Während Borchmeyer eine hoch bewertete
Qualifikationsarbeit im Rahmen eines pluralistischen Wissenschaftssystems in
assoziative Nähe zur nationalsozialistischen Bücherverbrennung bringt, gibt
Hellmut Karasek in der Welt vom 30. Juli den Betroffenen. Karasek kann gar
nicht anders als die "philologische Akribie und nötige Vorsicht" von Lorenz
zu registrieren, bevor er zu einer Gedächtnisreise in die frühen sechziger
Jahre aufbricht, als er im Zuge der Uraufführung von Eiche und Angora mit
Walser gesprochen hatte, zu einer Zeit, als sich Walsers Stolz und Scham
noch nicht so massiv artikuliert hätten, wie Jahre später in der
berüchtigten Paulskirchenrede. Widerwillig ringt sich Karasek in Erinnerung
an Äußerungen Walsers über Victor Klemperer zu dem Schluss durch, dass nach
Meinung Walsers Auschwitz nicht hätte geschehen müssen, hätten sich die
Juden vollständig assimiliert. Ein wie Karasek erschreckt einräumt
"ungeheuerlicher Gedanke".
Freilich waren sich Borchmeyers hysterische Wut und
Karaseks an der Grenze zum Stammeln operierende Erinnerung durchaus
steigerungsfähig. Ulrich Greiner nahm Matthias Lorenz Buch in der Zeit vom
1. September zum Anlass, ein als Buchkritik getarntes politisches Manifest
zu publizieren. Greiner hält Lorenz vor, in eine angebliche
"Antisemitismusfalle" zu geraten: "Wenn also Walser einem Juden negative
Eigenschaften zuordnet, so ist er Antisemit. Wenn er eine Romanperson mit
jenen negativen Eigenschaften ausstattet, die Antisemiten üblicherweise den
Juden zusprechen, ist er ebenfalls Antisemit, selbst dann und gerade dann,
wenn er zu verbergen trachtet, dass die gemeinte Person ein Jude ist." Warum
Greiner sein literatur- und kulturwissenschaftliches Wissen über Wirkung und
Funktion von Klischees und Stereotypen hier entweder vergisst oder
entwertet, wird deutlich, als er sich in einem Anfall von Selbsthass zum
durchschnittlichen deutschen Selbstverständnis äußert, das, wenn seine
Vermutung denn zuträfe, Anlass zu höchster Besorgnis böte.
Diese Besorgnis teilt Greiner jedoch keineswegs, im
Gegenteil. Er dürfte zu den ersten gehören, die einen Antisemitismus, der
nicht in Gewalt mündet, für salonfähig erklären. Der bahnbrechenden
Ehrlichkeit Greiners wegen lässt sich auf ein ausführliches Zitat nicht
verzichten: "Wer lang genug an der Oberfläche eines durchschnittlichen
Deutschen kratzt, muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann eine braune
Stelle findet. Das bedeutet aber nicht viel. Walser hat an keiner Stelle
seines Werks getrennte Parkbänke gefordert. Er ist Deutscher und legt Wert
darauf, es zu sein. Das schließt gemischte und heikle Empfindungen
naturgemäß ein. Wer sich aber vor Augen hält, was der wirkliche, der
aggressive Antisemitismus, wie man ihn bei den radikalen Muslimen oder auf
der äußersten Rechten findet, zu bewirken vermag, der kann das
Antisemitismusspiel nur erbärmlich finden."
... die aufgekratzten Stellen
Greiners Kritik hat den Autor, den er verteidigen wollte,
nämlich Martin Walser, ebenso beschädigt ("ein durchschnittlicher
Deutscher") wie er jenem Volk, um das es doch Walser geht, ein denkbar
schlechtes Zeugnis ausstellt. Dass Greiner bei seinem Gegenangriff darüber
hinaus so tief sinken würde, Walser und sein Werk mit Al Quaida, Hamas und
der NPD zu vergleichen, um dann erleichtert festzustellen, der
Schriftsteller habe wenigstens keine Apartheid für Juden gefordert, war
wirklich nicht zu vermuten. Wider seinen Willen gibt Greiner mit derlei
Einlassungen Lorenz in der Sache recht, und kann die "bedrückende
Beweislast", so Elke Schmitter im Spiegel vom 5. September, offensichtlich
nur dadurch neutralisieren, dass er den Befund bagatellisiert.
In Person und Werk Martin Walsers, das haben sowohl Lorenz
fulminante Dissertation als auch die gereizte Kritik an seiner Arbeit
gezeigt, finden offenbar jene - so wiederum Schmitter - ihr Sprachrohr, die
sich übergangen und des Nationalsozialismus' wegen für mitschuldig erklärt
sehen. Dass sich der Kreis dieser Vernachlässigten, Übergangenen und von
Ressentiment Getriebenen bis in den Kreis liberaler Professoren und
Feuilletonredakteure erstreckt, überrascht denn doch.
hagalil.com
12-09-05 |