|
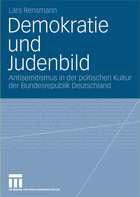
Lars Rensmann:
Demokratie und Judenbild. Antisemitismus in der politischen Kultur der
Bundesrepublik Deutschland
Verlag für Sozialwissenschaften 2004
Euro 42,90
Bestellen? |
Tief in der Mitte der Gesellschaft:
"Sekundärer" Antisemitismus
Lars Rensmanns Studie "Demokratie und
Judenbild" schärft den Blick für den "Schuldabwehr-Antisemitismus" und
erweitert das Instrumentarium seiner Analyse
Von Martin Jander
Tagesspiegel v. 28.06.2004
Diese Untersuchung erscheint zur rechten Zeit. Sie
lenkt den Blick auf ein heftig umstrittenes Phänomen: den Antisemitismus
in der politischen Kultur der Bundesrepublik. Lars Rensmann (FU-Berlin)
demonstriert in einer dicken, aber leicht lesbaren Untersuchung, dass
Antisemitismus in Deutschland keineswegs verschwunden ist. Er existiert
nicht nur an den politischen Rändern der Gesellschaft.
Den Kern der Untersuchung bilden fünf detaillierte
Studien zu zentralen Kontroversen der Bundesrepublik seit 1989. Der
Sozialwissenschaftler analysiert die politischen Debatten, die sich um
das Buch "Hitlers willige Vollstrecker" von Jonathan Goldhagen, die
Friedenspreisrede des Schriftstellers Martin Walser, das "Denkmal für
die ermordeten Juden Europas", die Zwangsarbeiter-Entschädigung und die
"Möllemann-Affäre" drehten. Er belegt hierbei nicht nur antisemitische
Ausfälle prominenter Schriftsteller und Politiker. Seine sehr
differenzierte Recherche in Bundestagsprotokollen, Pressemeldungen
gesellschaftlicher Organisationen und Leserbriefspalten von
Tageszeitungen zeigt darüber hinaus, dass antisemitische Äußerungen
politischer und intellektueller Autoritäten, die unwidersprochen
bleiben, einen tief in der Mitte der Gesellschaft verankerten
Antisemitismus aufrufen können.
Der moderne, oft auch "sekundär" genannte
Antisemitismus, unterscheidet sich zwar – wie der Autor einleuchtend
schildert - vom christlichen Antijudaismus des Mittelalters und dem
politischen Antisemitismus seit der Aufklärung. Er speist sich in
Deutschland vornehmlich aus dem Wunsch nach Schuldabwehr. "Die
Deutschen" – so hat Henryk Broder einmal treffend das Fazit der Studie
Rensmanns vorweggenommen – "werden den Juden Auschwitz nicht verzeihen."
Die Erinnerung an Auschwitz stört eine positive deutsche
Identitätskonstruktion, nach der in allen politischen Lagern der
Bundesrepublik gesucht wird.
Trotz dieser Unterschiede des modernen Antisemitismus zu
seinen vorangegangenen Erscheinungsformen werden jedoch Juden von vielen
Deutschen weiterhin als "rachsüchtige", "geldgierige" und einer
internationalen "Verschwörung" angehörende Störenfriede wahrgenommen und
angegriffen. Der Sozialwissenschaftler von der FU-Berlin zeigt, das fast
alle judenfeindlichen Stereotype vergangener Jahrhunderte im "modernen"
Antisemitismus wiederkehren. Oft scheint es, als wäre der "moderne"
Antisemitismus noch ganz der alte.
Die hohe Zahl offen antisemitischer Äußerungen,
körperlicher Angriffe und Grabschändungen, die seit 1989 Debatten über
die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands begleiten,
veranlassen Rensmann zur Skepsis gegenüber gängigen
Antisemitismus-Analysen. Antisemitismus sei in der Bundesrepublik zwar
geächtet und könne verfolgt werden. Aber immer dann, wenn sich nach
einem öffentlichen "Tabubruch" die Chance zeige, Vorurteile
unwidersprochen zu artikulieren, werde diese Chance auch von Menschen
aus der Mitte der Gesellschaft wahrgenommen. Das politisch
mobilisierbare antisemitische Potential gehe dabei weit über den
gewöhnlich mit etwa 20 Prozent angegebenen Umfang hinaus.
Der "moderne" Antisemitismus ist – wie "Demokratie und
Judenbild" zeigt - keine einfache Reaktion auf die unterschiedlichen
sozialen und politischen Umbrüche, denen die Gesellschaft der
Bundesrepublik durch die deutsche Einheit, die europäische Einigung und
den Prozess der Globalisierung ausgesetzt ist. Der moderne
antisemitische Wahn ist – wie seine Vorgänger – eine Projektion, eine
Zuschreibung, die mit Juden in der Bundesrepublik gar nichts zu tun hat.
Er speist sich aus nationalistischen, autoritären, antimodernen und
antisemitischen Unterströmungen traditioneller politischer Kultur in
Deutschland, die auch nach dem weitgehenden Aussterben der
NS-Tätergenerationen nicht verschwunden sind.
Dass dieser neue Antisemitismus lange Zeit nicht recht
beachtet wurde, hat auch mit verdrängten Ansätzen in der
sozialwissenschaftlichen Forschung zu tun. Obwohl das Thema des
"Schuldabwehrantisemitismus" bereits in Untersuchungen der aus dem Exil
nach Deutschland zurückgekehrten Mitglieder des "Frankfurter Instituts
für Sozialforschung" eine bedeutende Rolle spielte, hat die
sozialwissenschaftliche Forschung seine Brisanz erst spät entdeckt. Sie
hat darüber hinaus – wie Rensmann in seiner Untersuchung zeigt - die
linke Traditionslinie des Antisemitismus sträflich unterschätzt. Die
antisemitischen Konnotationen des "Antizionismus" der SED und vieler
sich "links" gerierender Gruppen der Bundesrepublik wurden oft erst gar
nicht untersucht.
Die Studie Lars Rensmanns sensibilisiert nicht nur den
Blick ihrer Leser für den "Schuldabwehrantisemitismus". Der Autor
erweitert das politikwissenschaftliche Instrumentarium der
Antisemitismus-Analyse. "Demokratie und Judenbild" ist eine
ausgezeichnete Studie voller beunruhigender Ergebnisse und Überlegungen.
Dr. Martin Jander, geb. 21.1.1955, Historiker, studierte
Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften an der Freien Universität
Berlin. Heute arbeitet er als freier Autor, forscht, lehrt und publiziert zu
den Themen Politische Theorien, Nationalsozialismus, Shoah und Deutsche
Nachkriegsgeschichte. Darüber hinaus ist er Mitarbeiter der Redaktion der
Zeitschrift „Horch und Guck“ und betreibt in Berlin die Stadtführungsagentur
"Unwrapping
History".
hagalil.com
02-07-04 |