
"Tripolis Praga". Die Prager "Moderne" um 1900. Katalogbuch
Hrsg. von Walter Schmitz und Ludger Udolph
W.E.B.
Universitäts-verlag 2001
Euro 24,80
Bestellen? |
Die Prager Moderne
um 1900:
Tripolis Praga
Als "eine farbenfrohe, mutige,
tolerante und neuschaffende Zeit" bezeichnete Vaclav Havel in seinem
Vorwort die Prager Moderne. "Gleichzeitig eine Zeit voll geheimnisvoller
Winkel, voll Trauer, Unverständnis und Entfremdung, laut die Erfahrung
einer scheinbar legitimen Absurdität der Welt äußernd." Es ist das
Verdienst des MitteleuropaZentrums an der TU Dresden, durch die
Ausstellung "Tripolis Praga" und das dazugehörige Katalogbuch die
vielfältigen Aspekte der Prager Kultur um 1900 zur Ansicht gebracht zu
haben.
Tschechen, Deutsche und Juden
verliehen der Stadt eine besondere Atmosphäre der Multikulturalität und
Kreativität. Während sich die tschechischen Künstler als "Avantgarde
einer Nationalkultur" sahen, "versuchte die deutsche Oberschicht ihre
abbröckelnde frühere Hegemonie durch eine breite 'Kulturarbeit' zu
beglaubigen." Juden schlossen sich zunächst den beiden
Bevölkerungsgruppen an, begaben sich jedoch mehr und mehr auf
Identitätssuche und Besinnung auf eine "nationale" jüdische Kultur.

Der 'Graben', die Fortsetzung der Ferdinandstraße,
Photographie, um 1890
Das Katalogbuch, erschienen im Thelem
Verlag, stellt die Dreivölkerstadt um 1900 in elf Kapiteln dar, die mit
zahlreichen Textbeispielen und Bildern die Vielfältigkeit der
untergegangenen Kultur beleuchten: Das "deutsche Prag", das vor
allem seit der Jahrhundertwende als Literaturstadt an Bedeutung gewann,
das
"tschechische Prag", das in Architektur, Politik und Künsten durch
das erwachende Nationalgefühl bestimmt war, und die wechselseitigen
kulturellen Wahrnehmungen, die im Kapitel "Begegnungen und
Vermittlungen"
veranschaulicht werden. Das "Magische Prag" zeigt das Bild auf und
das Selbstverständnis der Prager über ihre Stadt als "alte Zauberstadt",
wie es etwa Johannes Urzidil formulierte: "Hier kam vieles zusammen, Ost
und West, Jud und Christ, Tschech und Deutscher, Nord und Süd, und wo
viele Essenzen zusammenfließen, da entstehen auch viele zauberhafte,
unbegreifliche und sonst nie gesehene Dinge".

Gruppenfoto mit Leo Herrmann (Mitte), Hans Kohn (o.R.,
r.), Robert Weltsch (o.R., 2.v.r.) und seiner Schwester Lise
Weltsch-Kaznelson (u.R., 2.v.l.)
"Der Prager Kreis" widmet sich
jener Gruppe von deutschsprachigen jüdischen Avantgarde-Literaten, zu
deren innerem Kreis zunächst Max Brod, Franz Kafka, Oskar Baum und Felix
Weltsch gehörten. Die Prager Juden zwischen den Nationen, das "Erwachen"
des jüdischen Volkes und die kulturell-geistigen Errungenschaften dieser
Bewegung sind Thema des Kapitels "Jüdische Renaissance".

Josef und Karl
Capek, Photographie, um 1920 |
Das Kapitel "Zlatá
slovanská Praha" geht den verschiedenen
Mythen um die Stadt nach, den Mythen der Nation, wie der Seherin
Libussa, dem Mythos der "goldenen Stadt" und verschiedenen anderen
Mythen der Moderne, die mit Prag verwoben sind. Auch der
"Tschechischen Avantgarde" ist ein Kapitel gewidmet, das deren
wichtigste Vertreter vorstellt. Darunter beispielsweise die Brüder Josef
und Karl
Capek und den Anarchisten Jaroslav Hašek,
der 1911 die ersten Geschichte seiner Švejk-Figur
veröffentlichte.
"Aufbrüche und Ausbrüche"
stellt Prag als eine Stadt vor, die man auch verlassen musste, boten doch
Wien und Berlin entsprechende Alternativen, zumindest für die
deutschsprachigen Schriftsteller. Die deutsch-jüdisch-tschechische
Kultursymbiose wurde schließlich durch den Ersten "Weltkrieg"
radikal verändert: "Die vormals privilegierten Bevölkerungskreise und ihre
kulturellen Präferenzen wurden in der tschechoslowakischen Republik nach
1918 randständig."
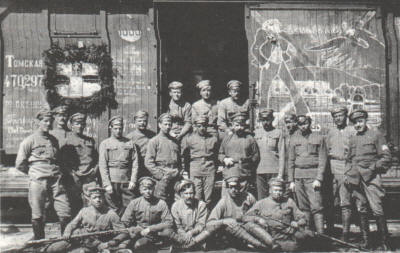
Die tschechische Legion, Photographie, um 1918
Das letzte Kapitel ist dem
"Gedächtnis" gewidmet, den Vergangenheitsdeutungen der Literaten der
"Prager Moderne". Ihre Erinnerung an die glanzvolle Ära der
Dreivölkerstadt, die endgültig durch die deutsche Okkupation beendet
wurde, stand der offiziellen Gedächtnispolitik des kommunistischen
Staates entgegen. In der Tschechoslowakei nach 1945/46 setzte "eine
rigide Nationalisierung der Tradition ein, die zunächst den
'Nationalitätenstreit' um 1900 endgültig zu entscheiden suchte, die aber
überdies die kritisch-analytische Literatur der 'Moderne' als dekadent
und formalistisch beargwöhnte und denunzierte."
Das Katalogbuch sei allen denen, die
die Ausstellung "Tripolis Praga" nicht gesehen haben, wärmstens
empfohlen. Diejenigen, die sie besucht haben, werden in der Vielzahl an
detaillreicher Darstellung noch viel Neues entdecken.
al / hagalil.com
18-04-04 |