|
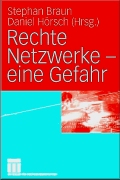
Stephan Braun, Daniel Hörsch (Hrsg.):
Rechte Netzwerke - eine Gefahr
VS Verlag für Sozialwissenschaften 2004
Euro 19,90
Bestellen? |
"Neue Rechte":
Rechte Netzwerke - eine Gefahr
Von Ralph Kummer
IDGR,
Informationsdienst gegen Rechtsextremismus
In der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte spielten
rechtsextreme Parteien - abgesehen von punktuellen Erfolgen bei Bundes-,
Landtags- oder Europawahlen - eine eher untergeordnete Rolle. Zudem ist
in den letzten Jahren ein immer größer werdender Bedeutungsverlust des
parteiförmig organisierten Rechtsextremismus zu beobachten. Und das,
obwohl laut Richard Stöss "in der Bundesrepublik ein erhebliches
Potenzial an latentem Rechtsextremismus ... [existiert]" (S.73).
Dieses Potenzial bildet aber zumindest den Nährboden für
die Herausbildung immer stärker verzweigter rechter Netzwerke. Sie
versuchen, dem stigmatisierten "rechten Ghetto" zu entkommen, den
vorpolitischen Raum nach ihrem Gusto ideologisch zu besetzen und wollen
Einfluss im politischen wie gesellschaftlichen Mainstream gewinnen.
Vernetzung triumphiert über formale Hierarchien. Gerade seit dem
Mauerfall 1989 haben informelle Projekte, eine Fülle von Medien mit
unterschiedlichen Profilen und Zielgruppen sowie flexible
Aktionsbündnisse Boden gegenüber starren, undynamischen Organisationen
gut gemacht.
Diese derart beschaffene neue soziale Bewegung von
rechts, vielfach "Neue Rechte" genannt, ist im Ganzen geprägt von
relativ losen Strukturen, informationeller Vernetzung und weist ein
ziemlich heterogenes Erscheinungsbild auf. Sie verfügt über ein
modernisiertes Auftreten, bemüht sich um eine Intellektualisierung der
rechten Szene. Darüber hinaus wird mit "politischer Mimikry" operiert,
einem scheinbar gemäßigten Duktus, wozu verbale Tarnung, sprachliche
Codes, Andeutungen und Unterschwelligkeiten gehören. Das Ziel der Neuen
Rechten ist es, die "kulturelle Hegemonie", die Meinungsführerschaft in
Deutschland zu erlangen. "Ihr Aktionsfeld ist weder die Straße noch sind
es die Parlamente, sondern die Diskurse, in die die Neue Rechte
eingreifen möchte, um einen politischen Klimawandel vorzubereiten"
(Thomas Pfeiffer, S.27). Neben fortwährender Angriffe auf eine angeblich
zu brechende Hegemonie der 68er bzw. der Linken generell, präsentiert
man sich als Nonkonformist, Tabubrecher oder Rebell gegen Denkverbote,
die angeblich aus der von der Linken forcierten, fast schon
staatsreligionsähnlichen Charakter innehabenden "Political Correctness"
resultierten.
Der vorliegende Sammelband will diesen rechten
Netzwerken näher auf den Grund gehen.
Der erste der drei Hauptteile befasst sich mit den
ideologischen Fundamenten und der Arbeitsweise der Neuen Rechten. Ferner
wird aufgedeckt, wie und wo diese Unterstützung findet. Wolfgang
Gessenharter macht mit einer Untersuchung über "Die Neue intellektuelle
Rechte und ihre Unterstützung durch Politik und Medien" den Anfang. Er
beschreibt vor allem die vier Hauptwege, über die es in den letzten
Jahrzehnten zu einer "Erosion der Abgrenzung" zwischen dem
Konservatismus der Mitte und der Neuen Rechten kam. Thomas Pfeiffer
analysiert die Neue Rechte als "Avantgarde und Ideologieschmiede des
Rechtsextremismus", geht dabei kurz auf historische Wurzeln, Strategie,
Mediennetz und ideologische Inhalte ein. Nach den Artikeln von Anton
Maegerle über das "Autorengeflecht in der Grauzone" - es wird die
"Scharnierfunktion" von fünf Periodika zwischen Rechtskonservatismus und
-extremismus herausgearbeitet - und von Margarete Jäger - sie
verdeutlicht, wie die Rechte die Sprache, die Diskurse und auch das
Denken von Teilen der politischen Mitte geprägt hat und somit zu einer
"Verschiebung der Sagbarkeitsfelder" (S.46) beitrug - folgen zwei
weitere Beiträge: Oskar Niedermayer wirft einen Blick auf die
"Wahlerfolge ethnozentristisch-autoritärer Parteien in Deutschland",
Richard Stöss behandelt "Rechtsextreme Einstellungen und ihre Ursachen",
die den "Nährboden für rechte Netzwerke" bilden. Diese beiden Aufsätze
hätte man jedoch besser an den Anfang des ersten Hauptteils stellen
sollen. Zum einen, weil die Betrachtung der Wahlerfolge durchaus
sinnvoll erscheint, im Folgenden der Fokus aber gerade auf den nicht in
Parteien organisierten Rechtsextremismus gerichtet ist; zum anderen,
weil das Wissen über rechtsextreme Einstellungen und Ursachen zu den
Basics im Forschungsfeld "Rechtsextremismus" gehört und mithin nicht an
das Ende eines Kapitels platziert werden sollte, in dem vorher schon auf
viel speziellere Problemkreise eingegangen worden ist.
Der zweite Hauptteil beleuchtet einige Beispiele rechter
Netzwerke detaillierter: angefangen vom "Doppelspiel der Jungen Freiheit
am Beispiel der Hohmann-Affäre" (Helmut Kellershohn), über einen Blick
auf das Studienzentrum Weikersheim (Meinrad Heck) sowie den
Rechtsintellektuellen Albrecht Jebens (Anton Maegerle/Stephan Braun),
weiter über eine Auswahl von Bewegungen, Organisationen bzw.
Institutionen, die der neurechten/rechtsextremen Bildungs- und
Schulungsarbeit beim "Kampf um die Köpfe" dienen (Anton Maegerle/Daniel
Hörsch), bis hin zum als Modernisierungsmoment fungierenden RechtsRock
(Christian Dornbusch/Jan Raabe) und zu den Burschenschaften (Dietrich
Heither). Abgeschlossen wird dieser breit gefächerte Abschnitt von einem
Beitrag zum Thema "Gelder für die braune Szene" (Franziska Hundseder).
Besonderes Augenmerk verdient das dritte und letzte
Kapitel, welches sich mit den Gegenstrategien beschäftigt. Gerade diesen
Aspekt vernachlässigt die gängige Literatur häufig oder handelt ihn nur
sehr verallgemeinernd ab - hier wird ihm auf 109 Seiten nachgegangen.
Unter anderem stellen die Autoren die Arbeit der "Vereinigung gegen
Vergessen - für Demokratie" vor (Hans-Jochen Vogel), das Modellprojekt
"Team Z" zur Prävention wie Förderung von Zivilcourage (Siegfried
Frech), das CIVICs-Modell zur Entwicklung von Demokratiekompetenz durch
Erfahrung als Aufgabe der Schule (Anne Sliwka), schulische
Handlungsansätze gegen Rechtsextremismus und Gewalt (Wilfried
Schubarth), die Perspektiven schulischer und außerschulischer
Bildungsarbeit (Ulrike Hormel/Albert Scherr) oder das "Bündnis für
Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt" (Ute Vogt).
Kritisch wird analysiert, inwieweit die üblichen pädagogischen Konzepte
gegen Rechts ausreichen (Kurt Möller) oder ob Kommunale
Kriminalprävention ein geeigneter Ansatz sein kann (Thomas Feltes).
Auch die Neuen Medien, insbesondere das Internet, finden
Berücksichtigung: So wird die Frage aufgeworfen, welche Wirkung
rechtsextreme Internetseiten auf Jugendliche haben und was eine
medienpädagogische Projektarbeit zu leisten imstande ist (Stefan
Glaser). Eines der führenden Aufklärungs- und Informationsprojekte über
Rechtsextremismus im deutschsprachigen Internet - der Informationsdienst
gegen Rechtsextremismus (IDGR) - bringt Albrecht Kolthoff dem Leser
näher; David Gall und Andrea Livnat skizzieren Anfänge und Grundpfeiler
des größten deutschsprachig-jüdischen Onlinedienstes in Europa, haGalil
Online. Bemerkenswert ist der Beitrag von Klaus Parker, der dem
Irrglauben entgegentritt, das Internet sei ein weit gehend rechtsfreier
Raum, der kaum eine Strafverfolgung rechtsextremer Propagandatätigkeiten
zulasse.
Ein Personen- und Sachregister sowie Informationen zu
den Autoren und Herausgebern beschließen den Sammelband.
Alles in allem deckt diese Publikation eine ziemlich
große Bandbreite an Themen ab. Vorteilhaft wäre es daher gewesen, den
einzelnen Hauptteilen einen knappen, zusammenfassenden Einführungstext
voranzustellen, der auf die folgenden Vertiefungsbeiträge verweist,
diese inhaltlich verknüpft und somit als Klammer für das entsprechende
Kapitel dient. Aufgrund des Fehlens einer solchen Klammer scheint
bisweilen bei der Aneinanderreihung der einzelnen Beiträge ein "roter
Faden" zu fehlen, andererseits korrespondiert die Vielschichtigkeit und
thematische Reichweite der Artikel im gewissen Sinne mit dem komplexen,
ausdifferenzierten (neu)rechten Netzwerk. Durch die eher kurzen, stets
kompetent verfassten Texte kann der Leser sowohl einen ersten Eindruck
von den jeweiligen Bereichen gewinnen als auch aktuelle Analysen
studieren (z.B. zur Hohmann-Affäre) und sich mit dem neuesten
Forschungsstand vertraut machen. Außerordentlich anerkennenswert ist das
dritte Kapitel, welches sich mit möglichen Gegenstrategien beschäftigt.
Dadurch hebt sich dieses 281 Seiten starke Buch von zahlreichen anderen,
thematisch ähnlich gelagerten Veröffentlichungen wohltuend ab.
Insgesamt ist der von Stephan Braun und Daniel Hörsch
herausgegebene Sammelband zu empfehlen, um sich in komprimierter Form in
die vielen Facetten "Rechter Netzwerke" einzuarbeiten und um
mannigfaltige Ansätze zivilgesellschaftlicher Gegenmacht kennen zu
lernen.
Rechte Netzwerke:
Eine
Gefahr
Viele Bücher, die das Thema Rechtsextremismus behandeln, gehen ausführlich
auf die von diesem ausgehenden Gefahren ein, bieten jedoch keine
Gegenstrategien an...
hagalil.com
10-11-04 |