Regionalgeschichte:
Die jüdische Arztfamilie Levi in Pfalzgrafenweiler
Im Jahre 2001 war Sanitätsarzt Dr. Julius Levi 100
Jahre Ehrenbürger von Pfalzgrafenweiler, einer Gemeinde etwa 70 km südlich
von Stuttgart. Für Andreas Hirling war dies der Anlass, das Schicksal der
Familie, auf die er rein zufällig gestoßen ist, genauer zu recherchieren.
Für seine Bemühungen erhielt er 2002 den Landespreis für Heimatforschung.
Mittlerweile liegt sein Buch "Leben für die Gemeinde" vor, eine detaillierte
Arbeit zur Orts- und Regionalgeschichte und gleichzeitig ein Stück
Vergangenheitsbewältigung.
Eingebettet in die Geschichte der Juden in Württemberg und
der Gemeinde Pfalzgrafenweiler im "Dritten Reich" zeichnet Hirling das
Schicksal der Levis nach. Als Julius Levi 1937 im Alter von 86 Jahren
verstarb und der damalige
Pfarrverweser Sihler die Kirchenglocken während des Trauerzuges läuten ließ,
titelte die nationalsozialistische Hetzzeitung "Flammenzeichen":
"Evangelisches Grabgeläute für einen Juden!" Die Teilnehmer des Trauerzuges
mussten sich daraufhin teilweise im Rathaus rechtfertigen.

Sanitätsarzt Dr. Julius Levi und Ernestine Levi
im Jahr 1914 |
Das Ehepaar Levi hatte insgesamt 18
Kinder, allerdings erreichten nur neun das Erwachsenenalter. Fünf von ihnen
wurden Opfer des Nationalsozialismus. Max Levi war behindert und wurde
wahrscheinlich im Rahmen des Euthanasieprogramms umgebracht. Erich, Clara
und Josefine Levi sind nach Polen deportiert und in Konzentrationslagern
umgebracht worden. Adolf Levi war, nachdem ihm die Approbation entzogen
worden war, als sog. "Behandler" in einem Krankenlager für Zwangsarbeiter,
bei einem englischen Tieffliegerangriff ums Leben gekommen.
Zahlreiche Hinweise deuten
darauf, dass die Bürger der Gemeinde den Levis die Treue hielten und sie in
schwerer Zeit unterstützten. Dennoch war Pfalzgrafenweiler keine 'Insel der
Glückseligen'. Auch hier gab es sämtliche antisemitische Repressalien:
Boykott, Judensternverordnung, Schwimmbadverbot, gekürzte
Lebensmittelkarten, Wohnungsübernahme, Deportation, Enteignung, das Tragen
der jüdischen Vornamen Sara oder Israel, Ausschluss aus Vereinen und vieles
mehr, die Andreas Hirling ausführlich dokumentiert.
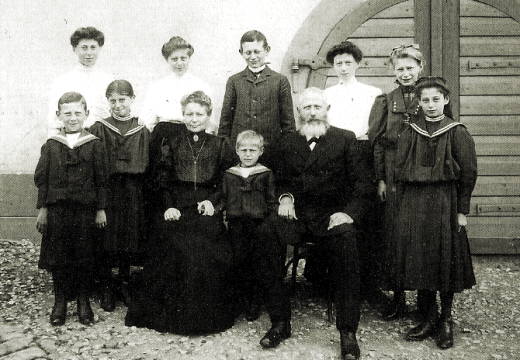
Die Familie Levi, ca. 1910, vor dem Rathaus in
Pfalzgrafenweiler
Auch die Geschichte Pfalzgrafenweilers im "Dritten Reich"
findet in Andreas Hirlings Buch Eingang, wenn auch in Form von
"Mosaiksteinen, die einen groben Überblick und Anregungen für weitere
Forschungen geben sollen". Hirling dokumentiert die Wahlergebnisse,
Gleichschaltung des Gemeinderates und öffentliche Ereignisse, wie
beispielsweise die Einweihung des "Adolf-Hitler-Brunnens" im September 1933.
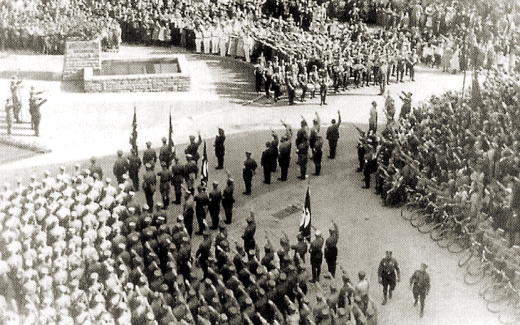
"Sieghaft wie eine uneinnehmbare Festung steht der
Brunnenstock da, so wie Adolf Hitler als Führer im Volke."
Andreas Hirling hat mit seinem engagierten Vorgehen ein
bemerkenswertes Beispiel gesetzt, das zeigt, wie Engagement dazu beitragen
kann, das Schicksal Einzelner nicht dem Vergessen anheim fallen zu lassen,
"Schicksale von Menschen, die einmal wirklich gelebt haben, die unsere
Nachbarn und Mitmenschen waren."
Andreas Hirling: Leben für die Gemeinde. Das Schicksal
der jüdischen Arztfamilie Levi in Pfalzgrafenweiler
Verlag Sindlinger-Buchartz,
ISBN 3-928812-32-7
Euro 12,50
al / hagalil.com
13-05-04 |