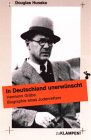
Douglas K. Huneke: In Deutschland unerwünscht.
Hermann Gräbe – Biographie eines Judenretters.
Dietrich zu Klampen Verlag, Lüneburg 2002
24 Euro
Bestellen? |
Das Leben eines der wenigen
Deutschen, die Juden vor dem Holocaust gerettet haben, müßte
große Aufmerksamkeit erregen – sollte man meinen. Dem ist aber
nicht so! Jahrzehntelang wollte niemand etwas über Hermann
Friedrich Gräbe wissen – erst jetzt ist seine bereits 1985
erschienene Biographie von Douglas K. Huneke auch auf deutsch zu
haben.
Als Bauingenieur wurde Gräbe in Sdolbunow (bei Rowno) im
ukrainischen Wolhynien vor allem für die Instandhaltung von Gleisanlagen
eingesetzt. Durch Beschäftigung jüdischer Arbeitskräfte, Fälschung von Papieren,
immer neuen Baustellen, zwischen denen er »seine« Arbeiter hin und her verschob,
konnte Gräbe viele dem Zugriff der Mörder entziehen.
Gräbe wurde Zeuge der Massaker an der jüdischen Bevölkerung
Rownos und Dubnos, bei der jeweils 5000 Menschen ermordet wurden. Im Nürnberger
Hauptkriegsverbrecherprozeß sagte er darüber aus. Der Gebietskommissar, der
unter anderem für Gräbes Baustellen zuständig war, Georg Marschall, wurde
aufgrund von Gräbes Aussagen wegen der Erhängung eines Juden angeklagt. Seine
Unterstützung für die zahlreichen Massaker durch SS-Einsatzgruppen und
ukrainische Milizen gelangte hingegen nicht vor Gericht. Für den Mord an dem
einen Juden wurde er im ersten Prozeß zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt.
Im Revisionsverfahren 1966/67 arbeitete Marschalls Anwalt mit Verleumdungen des
Hauptbelastungszeugen, dessen Glaubwürdigkeit er erschüttern wollte. Auch wenn
das Gericht ihm dabei nur teilweise folgte, ging die Taktik auf. Marschall sei
nur der Beihilfe schuldig. Er wurde zu fünf Jahren verurteilt, die mit der
bisherigen Haftzeit abgegolten waren.
Mit dem Vormarsch der Roten Armee wurde die Lage für Gräbes
Baukolonnen immer prekärer, auf wundersame Weise gelang es ihnen, sich unter
Ausnutzung der Kriegswirren bis nach Westdeutschland durchzuschlagen, wo sie
sich von der US-Armee überrollen ließen. Gräbe hatte es in den Jahren zuvor
wieder und wieder geschafft, von deutschen Behörden, der Wehrmacht, aber auch
von NSDAP-Stellen Ausnahmegenehmigungen für seinen Bautrupp zu erhalten, da er
wehrwirtschaftlich relevante Bauaufträge auszuführen habe.
Nicht weniger interessant als die Rettungsaktionen ist der Umgang
mit Gräbe nach 1945, mit dem sich zwei neuere Beiträge im Anhang des Buches
befassen. Während Gräbe international hoch geehrt wurde – 1965 in Yad Vashem als
»Gerechter unter den Völkern« –, wollte in Deutschland bis in die 90er Jahre
niemand etwas von dem »Nestbeschmutzer« wissen. Bereits 1948 sah er sich
gezwungen, in die USA zu emigrieren. Als Zeuge im bereits erwähnten
Marschall-Prozeß wurde er nicht nur vom Anwalt des Angeklagten verleumdet. Der
Spiegel übernahm 1965 fast komplett dessen Version. In seiner Heimatstadt griff
das »Solinger Tageblatt« die Beschuldigungen des Spiegels begierig auf. Der
Artikel gipfelte in der Forderung nach Wiederaufnahme der Verfahren des
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses. Von den NS-Verbrechen wollte man nichts
mehr wissen, der Schlußstrich, darin waren sich die meisten einig, sollte
endlich gezogen werden. Dieses Klima wandelte sich erst später; in den 90er
Jahren gedachte dann auch Solingen Gräbes mit einer Gedenktafel an seinem
Geburtshaus. Nachdem Gräbe in den 60er Jahren in Prozessen ausgesagt hatte,
besuchte er Deutschland nie wieder. Am 17. April 1986 starb Hermann Friedrich
Gräbe in den USA. |