|
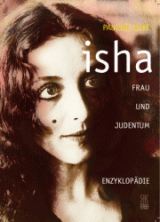
Pauline Bebe:
ISHA —
Frau und Judentum ·
Enzyklopädie
Umfang ca. 480 Seiten,
Gebunden mit
Schutzumschlag,
Euro 34,00
Bestellen? LESEPROBE:
Abtreibung
Bat Mizwah
Ehe
Esther
Lilith
Mikwe
Sexistische
Sprache
Toralesung |
Isha:
Frau und Judentum
Rezension von Iris Noah
Eine Enzyklopädie – nicht mehr und nicht weniger –
verspricht der Verlag zum Thema Frau und Judentum. Herausgekommen ist
ein umfangreiches Nachschlagewerk mit etwas über 100 Artikeln: Frauen
aus der Torah sowie einige aus dem Talmud.
Außerdem werden Begriffe erklärt, die eine besondere
Bedeutung im Leben von Frauen haben – sei es durch die jüdische
Tradition bedingt (Mechiza, Mikwe, Erbrecht) oder dadurch dass sie aus
der Sicht von Frauen einer Revision unterzogen worden sind (Minjan,
Tefillin, Rosch Chodesch).
Die Verfasserin, Pauline Bebe, arbeitet seit ihrer Ordination zur
Rabbinerin im Jahr 1990 in einer liberalen Gemeinde in Paris.
Neuere Entwicklungen zu Ritualen oder Segenssprüchen
werden kaum thematisiert, und wenn, dann muß man schon sehr genau
wissen, wo man sucht, z.B. unter "Brit Leda", wenn es um die Aufnahme
des Mädchens in den Bund bzw. dessen Namensgebung geht. Im Mikwe-Artikel
heißt es:
"Eine neue Liturgie müsste für all diejenigen Ereignisse
gefunden werden, die noch keinen Platz in der Tradition haben. Solche
kreativen Texte könnten von Rabbinern und Rabbinerinnen oder auch von
den Benutzerinnen der Mikwe entwickelt werden" (Seite 215).
Diese Bemerkung erstaunt, wenn man weiß, dass dies seit
mehr als 20 Jahren in den USA geschieht. Viele der modernen Quellentexte
auf die sich Bebe bezieht, sind von amerikanischen Autorinnen. Auch in
Großbritannien und auf dem europäischen Kontinent gibt es Ansätze in
dieser Richtung. Hier bleibt das Buch sehr vage.
Ärgerlich ist, wie sich an manchen Stellen die Fehler,
Fehlwahrnehmungen und falschen Interpretationen häufen. So wird im
Artikel über "Rabbiner und Rabbinerinnen" Regina Jonas richtig als erste
Frau, die als Rabbinerin ordiniert wurde, benannt. Dann heißt es:
"Zusammen mit sechsundzwanzig anderen Frauen belegte sie
den Rabbinerlehrgang an der Hochschule für die Wissenschaft des
Judentums, von der sie 1930 den Titel Professorin für Religion verliehen
bekam" (Seite 254).
Es gab keinen Rabbinerlehrgang für Frauen an der
Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Regina Jonas strebte das
Rabbinat an, was von ihren Mitstudentinnen als ungewöhnlich und kurios
eingeordnet wurde. Frauen konnten sich an dieser Institution
einschreiben und auf akademischem Niveau lernen. Sie konnten den Titel
"akademisch geprüfte Religionslehrerin" erwerben, was auch Regina Jonas
tat. "Professor für Religion" wurde hier niemand, denn die Hochschule
hatte kein Promotions- bzw. Habilitationsrecht.
Einige Zeilen später heißt es, dass seit 1972 – als mit
Sally Priesand die erste Frau nach Regina Jonas ordiniert worden sei,
mehr als 400 Frauen Rabbinerinnen geworden seien. Selbst wenn man das
Erscheinungsjahr 2001 der französischen Orginalausgabe zugrunde legt, so
ist das stark untertrieben.
Wer eine erste Orientierung zum Themenbereich jüdische
Frauen sucht, wird in diesem Buch fündig. Wer mit dem Thema bereits
etwas vertraut ist und sich Aufschluß über neuere Entwicklungen erhofft,
wird enttäuscht und sollte sich auf der Internetseite von
Bet Debora –
Tagung europäischer Rabbinerinnen, Kantorinnen und Aktivistinnen
umsehen.
Fazit: Insgesamt wird das Werk seinem Anspruch eine
Enzyklopädie zu sein nicht gerecht.
hagalil.com
01-02-05 |