|
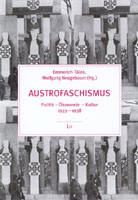
Emmerich Tálos, Wolfgang Neugebauer (Hg.):
Austrofaschismus
Politik – Ökonomie – Kultur 1933 – 1938
Lit Verlag Wien 2005
Euro 19,90
Bestellen?

Manfred Scheuch:
Der Weg zum Heldenplatz.
Eine Geschichte der österreichischen Diktatur 1933-1938
Kremayr & Scheriau/Orac Wien 2005
Euro 24,00
Bestellen? |
Zum Gedenkjahr:
"Ständestaat" oder Austrofaschismus?
Zwei Rezensionen von Karl Pfeifer
Rechtzeitig für das "Gedankenjahr" in Österreich sind
zwei bemerkenswerte Bücher zur Geschichte des Austrofaschismus
erschienen, ein wissenschaftliches Sammelwerk und eine
populärwissenschaftliche Geschichte, beide lesens- und empfehlenswert.
Austrofaschismus 1933 – 1938
Nach der Gründung der Zweiten Republik, wurde die
Geschichte des autoritären Systems, das der NS-Herrschaft vorausging,
vielfach tabuisiert. Der Grund liegt auf der Hand, die ÖVP –
Nachfolgepartei der Christlichsozialen – war die stärkste Partei. Doch
gerade jetzt, in einer Zeit in der dieses im eigenen Verständnis
demokratiefeindliches System beschönigt und verharmlost wird, ist ein
nüchterner Blick in die Vergangenheit notwendig.
Die letzte Auflage dieses Sammelbandes erschien 1984.
Seither kam die Geschichtswissenschaft zu neuen Erkenntnissen und die
erweiterte Auflage mit neun vollkommen neuen Beiträgen ist im April 2005
erschienen. Es ist keine aktuell politische Auseinandersetzung mit der
jetzt üblichen Verharmlosung dieser spezifisch österreichischen Variante
des Faschismus.
Unstrittig ist, dass die Regierungen Dollfuß und
Schuschnigg gegen NS-Terror und nationalsozialistische Politik
Widerstand geleistet haben. Ihr Widerstand galt allerdings nicht der
Verteidigung eines selbständigen und demokratischen Österreichs, sondern
der Aufrechterhaltung einer Diktatur, die in Konkurrenz zum
Nationalsozialismus stand. Die seit dem Jahr 1936 infolge des
anwachsenden NS-Drucks von innen und außen sowie des Verlustes des
italienischen Protektors verstärkte politische Dynamik endete im Jahr
1938 im Desaster der vergleichsweise wenig gefestigten Diktatur und im
von vielen Österreichern bejubelten "Anschluss".
Besonders wertvoll der neue Beitrag "Nationalsozialisten
in Österreich 1933 – 1938" von Winfried R. Garscha, der darauf hinweist,
dass das populäre Geschichtsbild in den ehemaligen Hochburgen der
illegalen NSDAP in Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und Kärnten
von der offiziellen Einstufung der "Illegalen" merklich abweicht, u.a.
wird der Terror der NSDAP, der fast 200 Opfer forderte, als
"Lausbubenstreiche" verharmlost, der Antisemitismus und der
demokratiefeindliche Charakter der illegalen NSDAP verleugnet. Die
"Illegalen" werden als Idealisten hingestellt, die nach dem "Anschluss"
angeblich zu "Opfern" wurden. So wird die in Österreich so beliebte
Opfer-Täter-Umkehr vollzogen. "Der hohe Anteil der "Illegalen" unter den
Arisierungsgewinnlern ebenso wie in den Besatzungsbürokratien der
eroberten Länder während des Krieges wird ebenso negiert wie die
Tatsache, dass gerade die "Illegalen" in besonders hohem Ausmaß beim
Aufbau des Terrorapparats von Gestapo, SS und SD in Österreich
eingesetzt wurden.
Keine Frage, dass die von manchen Sozialdemokraten
vertretene Ansicht, dass der Austrofaschismus schlimmer war als der
Nationalsozialismus nur rechtfertigen soll, dass viele Sozialdemokraten
aus Zorn gegen die nach 1933 eingeführte Diktatur 1938 ihren Weg in das
Lager der Nazi fanden, bzw. sich nicht gegen die viel üblere
Naziherrschaft stellten.
Besonders lehrreich "Der Politische Katholizismus..."
von Ernst Hanisch, der Austrofaschismus unter Anführungszeichen setzt
und in seinem nuancierten Beitrag auch aufzeigt, dass die Kirche nicht
ganz kritiklos die Diktatur unterstützte und sich auch der
Gleichschaltung widersetzte und sich gelegentlich sogar distanzierte.
Angelika Königseder befasst sich mit "Antisemitismus
1933 – 1938" und zeigt, dass nach dem Verbot der Sozialdemokratie, die
Bedeutung des Antisemitismus als politische Waffe geringer wurde. Auch
garantierte – allerdings nur auf dem Papier – die ständestaatliche
Verfassung Juden die uneingeschränkten bürgerlichen Rechte und die
Religionsfreiheit.
Doch trotz aller Zurückhaltung wollte man den Nazi nicht
dieses Feld überlassen. Zwar haben die Christlichsoziale Partei und die
Kirche den Rassenantisemitismus abgelehnt, aber z.B. die "Vereinigung
christlich-deutscher Ärzte" propagierte rassistischen Antisemitismus in
ihrem Programm: "In der Rassenfrage vertritt der Verein
christlich-deutscher Ärzte den Standpunkt, dass die Rasse als
Gegebenheit der natürlichen Ordnung zu pflegen und zu respektieren ist.
[...] Bezüglich der Judenfrage vertritt der Verein christlich-deutscher
Ärzte den Standpunkt, dass mit aller Entschiedenheit und Schärfe die
zersetzenden Einflüsse zu bekämpfen sind, die sich aus dem Geiste eines
entwurzelten Judentums ergeben."
Die Christlichsozialen betonten die vermeintliche
Überlegenheit des eigenen Antisemitismus, um den Nationalsozialisten
"den Wind aus den Segeln zu nehmen". Am 17. März 1933 erschien z.B. in
der "Reichspost" ein Artikel unter dem Titel "Kein Antisemitismus im
Dritten Reich", der sich mit der zuvor veröffentlichten Erklärung
Görings beschäftigte, dass staatstreue jüdische Bürger im Deutschen
Reich nichts zu befürchten hätten. Darin war zu lesen: "So beginnt das
'gigantische Aufbauwerk des Nationalsozialismus' [...] de facto mit
einer großzügigen Judenschutzaktion, und die Massen, die den Aposteln
des radikalsten Rassenantisemitismus zur Macht verholfen haben, haben
das Nachsehen [...] Kurz, es ist nichts mit dem Antisemitismus im
Zeichen des Hakenkreuzes. [...] Die großen Sprüche vor der Mahlzeit
waren eben nur große Sprüche, nach dem Mahle liest sich's anders."
Die Autorin zitiert auch den Führer der christlichen
Arbeiterbewegung Leopold Kunschak, einen Gegner des Nationalsozialismus,
der sich noch nach der Befreiung Österreichs 1945 als lebenslanger
Antisemit bekannte und meinte in Österreich hätten weder einheimische
noch fremde Juden etwas zu suchen.
Bis heute versucht man den hier noch immer tief
verwurzelten Antisemitismus auf den Nationalsozialismus zu reduzieren.
Doch diesen gab es in Österreich lange bevor dem "Anschluss" und leider
auch nachher.
Es wäre an der Zeit, dass sich auch die ÖVP
selbstkritisch mit dieser Geschichte befasst. Gerade solche Werke, wie
"Austrofaschismus", dessen Autoren nicht in allen Punkten
übereinstimmen, sollten dem eigenen Publikum vorgestellt werden. Denn
die stereotype Widerholung von Halbwahrheiten über den "Ständestaat"
wirken – angesichts der in diesem Buche aufgezeigten Fakten –
lächerlich.
Der 435 Seiten umfassende Sammelband, der sich auf die
zentralen Aspekte der autoritären Diktatur fokussiert, befasst sich von
der Konstituierung, den bestimmenden Ideologien, politischen Strukturen
und Akteuren bis hin zu Politikfeldern wie Sozial-, Frauen-,
Wirtschafts-, Repressions-, Schul-, Kultur- und Außenpolitik. Der
Sammelband ist die bisher umfassendste Analyse des Austrofaschismus und
damit ein Gewinn für alle, die sich mit österreichischer Geschichte
befassen.
Der Weg zum Heldenplatz
Manfred Scheuch, langjähriger Chefredakteur der AZ,
erzählt gekonnt die Geschichte der "österreichischen Diktatur" in der
Zeit von 1933 bis zum "Anschluss".
Er erkennt eindeutig die "Merkmale des Faschismus" im
"Ständestaat":
• Die Ausschaltung des Parlaments in Form eines "kalten Staatsstreich",
das Verbot der Parteien, der Verfassungsbruch.
• Die Beseitigung der Freiheitsrechte des Individuums, Aufhebung von
Versammlungs- und Vereinigungsrecht sowie Pressefreiheit.
• Das Führerprinzip.
• Das Grundbekenntnis der Feindschaft gegenüber der Sozialdemokratie und
dem Marxismus.
• Die gewalttätige Austragung des Kampfes gegen die Arbeiterbewegung durch
bewaffnete Organisationen.
• Die Entrechtung der Arbeiterschaft durch Streikverbot, Sozialabbau,
Einzwängung in ein berufständisches System.
• Verfolgung politischer Gegner
Doch im Gegensatz zu Deutschland und Italien gelang es
weder Dollfuß noch Schuschnigg eine Massenbasis zu schaffen. Ihr Weg
führte zu Hitlers Triumph auf dem Wiener Heldenplatz. Auch wenn
konservative Historiker dies anders sehen, es genügt nicht lediglich die
aktive oder wegschauende Beteiligung von Österreichern an den Verbrechen
der deutsch-österreichischen Volksgemeinschaft anzuerkennen, auch die
Zeit davor sollte – "mit dem Blick auf die Zerstörung der Demokratie,
aber auch auf den Antisemitismus und die Haltung einer politisierenden
Kirche – ein Gebot historischer Gewissensforschung" werden.
Der sozialdemokratische Autor stellt fest, dass die
Sozialisten nicht bereit sind, eine "auch ungleich zu wägende –
"geteilte Schuld" für die Katastrophe" anzuerkennen und resümiert: "Die
Dollfußstraße hatte, wie die Sozialisten schon vor Jahren gewarnt
hatten, zu Hitlers Triumph geführt. Freilich meinte so mancher zum Fall
des austrofaschistischen Regimes, unter dem die Arbeiter nur Elend,
Arbeitslosigkeit und Unterdrückung erlebt hatten, schlimmer könne es
auch nicht mehr kommen. Eine kurzsichtige und für Millionen tödliche
Illusion."
Manfred Scheuch hat gründlich recherchiert und legt auf
254 Seiten einen spannenden Abriss einer umstrittenen Periode
österreichischer Geschichte vor, die mit der Abschaffung der Demokratie
begann und in der nationalsozialistischen Barbarei mündete.
hagalil.com
13-04-04 |