|
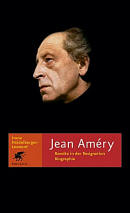
Irene Heidelberger-Leonard:
Jean Améry.
Revolte in der Resignation. Biographie
Klett-Cotta Verlag 2004
Euro 24,00
Bestellen? |
Revolte in der Resignation:
Jean Améry – eine Biographie
Rezension von Karl Pfeifer
Bevor ich die von Irene
Heiderlberger-Leonard verfasste Biographie las, waren mir die
blitzgescheiten Artikel von Améry, die in Schweizer und deutschen
Zeitungen erschienen, ein Begriff. Besonders beeindruckt sein 1969
publizierter Artikel "Der
ehrbare Antisemitismus", der leider bis heute aktuell geblieben ist.
Die Autorin hat gründlich recherchiert. Der in
Wien 1912 als Hans (Chaim) Maier (es gibt mehrere Schreibweisen seines
Namens) geborene, nach dem Krieg unter dem Namen Jean Améry schreibende
und bekannt gewordene Journalist und Schriftsteller wurde katholisch
erzogen und wuchs im Salzkammergut auf. Nach einer Buchhandelslehre
studierte er unregelmäßig Literatur und Philosophie, war Buchhändler in
der Buchhandlung des Wiener Volksheims Leopoldstadt. Er gab mit Ernst
Mayer die kurzlebige literarische Zeitschrift "Die Brücke" heraus und
flüchtete 1938 nach Antwerpen, wo er von der jüdischen Gemeinde Hilfe
erhielt. Im Mai 1940 als feindlicher Ausländer festgenommen, wurde er in
Südfrankreich im Lager Gurs interniert, von wo ihm 1941 die Flucht
gelang. Nach seiner Rückkehr nach Brüssel nahm er teil an der Arbeit
einer kleinen Gruppe österreichischer Kommunisten bei der Herstellung
von Flugblättern, die unter deutschen Besatzungssoldaten verteilt
wurden.
Améry erkannte 1965 lakonisch, "dass wir unser
dürftiges Wort an taube Ohren richteten. Ich habe manchen Grund zur
Annahme, dass die feldgrauen Soldaten, die unsere vervielfältigten
Schriften vor ihren Kasernen fanden, sie stracks und hackenklappend
ihren Vorgesetzten weitergaben, die ihrerseits dann mit der gleichen
dienstlichen Fixigkeit die Sicherheitsbehörden verständigten. So kamen
diese letztgenannten uns denn auch ziemlich schnell auf die Spur und
hoben uns aus. Auf einem der Flugblätter, die ich im Augenblick meiner
Festnahme bei mir trug, stand ebenso bündig wie propagandistisch
ungeschickt: 'Tod den SS-Banditen und Gestapohenkern.'"
Améry, gab die anderen Mitglieder der Gruppe
nicht preis und wurde der Folter unterworfen. Er hat dies im Essay "Die
Tortur" (1965) literarisch aufgearbeitet. Als Jude enttarnt, traf er am
17. Januar 1944 in Auschwitz ein. In seinem Text "Zur Psychologie des
deutschen Volkes" schrieb Améry:
"Konzentrationslager Auschwitz, im Januar
1944: Nach Ankunft eines Transportes von einigen hundert Juden, Männern,
Frauen und Kindern, werden diese auf die gewohnte Weise durch SS-Leute
eingeteilt. Man trennt zunächst die arbeitsfähigen Männer von Frauen,
Kindern und Greisen und löst schließlich auch diese zweite Gruppe auf,
indem man den Kindern die Mütter wegnimmt. (...). Eine Frau (...) löst
sich plötzlich mit aufgelöstem Haar und tragischen Gebärden von ihren
Genossinnen und fragt schreiend, bereits mit sichtlichen Anzeichen
beginnender Geistesgestörheit, nach ihrem Kinde. (...) Sie gerät an
einen wachthabenden SS-Mann. "Mein Kind", sagt sie, "haben Sie nirgends
mein Kind gesehen?"
"Ein Kind willst Du" antwortet der SS Mann mit vollkommener Ruhe,
"warte..." Und er geht sehr langsam auf die Gruppe (...) der Kleinen zu.
Er bückt sich und ergreift einen etwa vierjährigen Knaben beim Fuß. Er
hebt ihn hoch und wirbelt ihn einige Male durch die Luft, wobei der den
kleinen Kopf an einem eisernen Pfeiler zerschmettert. (...)"
Améry hatte Glück im Unglück und durfte als
der deutschen Orthographie kundiger Schreiber im Büro eines im Bau
befindlichen I.G.Farben-Werkes arbeiten. Er musste stundenlang am
Appellplatz stehen, bekam 200 Gramm Brot und zwei Wassersuppen am Tag.
Aus Solidarität mit den anderen geschundenen Menschen empörte er sich
bei seinem Vorgesetzten über die mörderischen Arbeitsbedingungen, unter
denen die anderen Häftlinge weiterhin darben. "Ja, Mayer", meinte der
Meister, "so darf man die Dinge nicht ansehen. Man kann es eben nicht
allen recht machen. Aber die Arbeit, Mayer, die Arbeit muss gemacht
werden, man verlangt sie ja von mir auch". Sein Einspruch hätte Améry
das Leben kosten können, aber sein Vorgesetzter war ihm gewogen.
Ende Januar 1945 wurde er zu Fuß evakuiert und
endlich am 15. April im KZ Bergen-Belsen von britischen Soldaten
befreit. 25.437 Juden wurden aus Belgien, davon 23.000 nach Auschwitz
deportiert. Hans Mayer ist einer der 615 Überlebenden. "Mit
fünfundvierzig Kilogramm Lebendgewicht und einem Zebra-Anzug", kehrte er
zurück nach Brüssel. Seine Frau Regina, die sich in Brüssel versteckt
gehalten hatte starb am 24. April 1944.
Für Améry ist die Lager-Erfahrung eine rein
destruktive: "Wir sind in Auschwitz nicht weiser geworden (...) nicht
'tiefer', (...) nicht besser, nicht menschlicher, nicht
menschenfreundlicher und sittlich reifer". Die Rolle, eines
Auschwitz-Überlebenden, der während der sechziger Jahre sich durch seine
Essays und Stellungnahmen in Deutschland einen Namen gemacht hatte und
deshalb zu Symposien und Konferenzen eingeladen wurde, war ihm zu tiefst
zuwider.
Im Buch wird die faszinierende indirekte
Diskussion zwischen Primo Levi und Jean Améry im Detail geschildert.
Levi glaubt, der Autodidakt Améry wäre ein arrivierter deutscher
Intellektueller und Améry sieht in Levi einen "Verzeiher". Das Leiden an
der nicht erfolgten Rache hat sich als Ressentiment heillos nach innen
gekehrt.
Hans Mayer weiß, er kann es bezeugen, dass
sie, die Durchschnittsdeutschen , "wussten": "So steht es fest und kann
hier voll verantwortlich bestätigt werden, dass die Arbeiter und
Angestellten des Werkes 'Auschwitz' der I.G. Farbenindustrie genau
wussten, dass in dem 5 km entfernten Ort Birkenau Hunderttausende von
Juden, Polen und Russen mit Gas vergiftet und teilweise sogar lebend
verbrannt wurden. In diesem Sonderfalle waren also ungefähr fünftausend
Deutsche gewesen, die von den teuflischsten aller ersinnbaren Methoden
Kenntnis hatten, aber nicht einer, der gerufen hätte: 'Halt! Das mach
ich nicht mehr mit'."
Améry erwog auch eine Rückkehr in sein
Geburtsland. 1946 schrieb er seiner späteren österreichischen Ehefrau:
"Freilich das Herz, liebe Mitzerl, das Herz zieht mich trotz alledem
nach Österreich, und es ist durchaus möglich, dass ich eines Tages über
Nacht abreise." Ingeborg Bachmann setzte in ihrer vielleicht schönsten
Erzählung "Drei Wege zum See" ein bewegendes Denkmal für Améry. Mit
großer Selbstverständlichkeit nennt sie ihn einen "Österreicher".
Die Gleichgültigkeit der Österreicher hat ihn
gekränkt. 1971 schrieb er an Ernst Fischer: "Was Sie mir über meine
Arbeit sagten, war schön und hat mich bewegt, nicht zuletzt weil ihre
Stimme für mich (...) aus Österreich zu mir herübertönt. (...) dem Lande
der Herkunft, wo man sich freilich ansonsten so gut wie nicht um mich
schert und mich in der schlechtsitzenden Rolle des bundesdeutschen
Schriftstellers meine Sache tun lässt."
Hans Mayer erhielt die österreichische
Staatsbürgerschaft, kehrte aber nicht zurück, denn "in a Wirtshaus aus
dem ma aussigschmissn worn is, geht ma nimmer eini." Endgültig kehrt er
in sein Heimatland nur zurück, um hier Selbstmord zu begehen und in
einem Ehrengrab der Stadt Wien begraben zu werden.
Hannah Arendts Buch "Eichmann in Jerusalem"
(1961) erregte seinen Widerwillen, insbesondere der Untertitel "Bericht
von der Banalität des Bösen", ein Begriff, der dem Gefolterten, dem der
sadistische Machtrausch seiner Peiniger noch so gegenwärtig war, wie
damals, Stachel zur leidenschaftlicher Widerrede war. "Es gibt nämlich
keine 'Banalität des Bösen', und Hannah Arendt, die in ihrem
Eichmann-Buch davon schrieb, kannte den Menschenfeind nur vom Hörensagen
und sah ihn nur durch den gläsernen Käfig."
Sein "Judesein" definiert Améry 1966: "Das
hieß für mich von diesem Anfang an, ein Toter auf Urlaub sein, ein zu
Ermordender, der nur durch Zufall noch nicht dort war, wohin er rechtens
gehörte." Nach dem Sechs-Tage-Krieg schreibt er: "Links war er immer
ausgeschritten, bis jetzt die Kraft der Beine erlahmte, wenn nämlich
linke Geschichtsbesessenheit aus den weltbedeutenden Blättern ihn
anredete und unter Sukkurs aller fortschrittlichen Geister von
Universitäten und Kirchen ihm klarmachte, dass und warum das winzige
Ländchen am Mittelmeer der Rechts- und Friedensbrecher war, ergo am
besten tat, sich selber eigenhändig abzuwürgen, was doch ein schwieriges
Unterfangen ist."
Sein "Katastrophen-Judesein" machte ihn zum
Zionisten. Erst mit der Gründung Israels, erklärte er, haben die Juden
aller Welt den aufrechten Gang wieder gelernt. Einem deutschen Freund
vertraute er an, dass allein die Nachrichten aus dem Nahen Osten ihn
interessieren, er sei "durcheinandergeraten – vor allem auch, was
(s)eine linke Einstellung betrifft."
Die Autorin schildert auch das Schicksal
seiner Bücher und die späten Ehrungen die Améry zuteil geworden sind.
Auf seinem Grabstein im Wiener Zentralfriedhof steht lediglich:
"JEAN AMÉRY 1912-1978
AUSCHWITZ NR. 172364".
Irene Heidelberger-Leonard, die auch die
Gesamtherausgeberin der bei Klett-Cotta erscheinenden Améry-Werkausgabe ist,
schließt ihre Biographie mit folgenden Sätzen: "1938 wird er wie eine
Ausgeburt des Teufels aus dem Land gejagt. 1978 wird der "Götterliebling" in
einem Ehrengrab in Wien bestattet."
Das Buch regt an, sich mit dem Werk von Jean
Améry auseinanderzusetzen.
hagalil.com
11-08-04 |