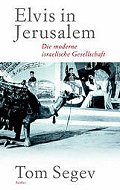
Tom Segev, Elvis in Jerusalem.
Die moderne israelische Gesellschaft.
Siedler Verlag 2003
Euro 18,00
Bestellen?
Tom Segev schreibt als Kolumnist für die israelische Tageszeitung
"Ha'aretz". Sein Buch
"One Palestine, Complete" wurde mit dem National Jewish Book Award
ausgezeichnet und von der "New York Times" zu den neun besten Büchern des
Jahres 2000 gezählt. In Deutschland wurde Segev 1995 durch
"Die siebte Million. Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung"
bekannt. Tom Segev lebt in Jerusalem. |
Tom Segev
über die israelische Gesellschaft:
"Elvis in Jerusalem"
Von Andrea Livnat
Was haben Theodor Herzl, Elvis, Ovadiah Josef und Gadi
Manella gemeinsam? Sie alle dienen Tom Segev dazu, in seinem jüngsten
Buch die moderne israelische Gesellschaft zu erklären. Im hebräischen
Orginal erschien das Buch 2001 unter dem Titel "Die neuen Zionisten",
eine Anspielung auf den Ausdruck der "neuen Historiker" und
Untermauerung der Grundthese Segevs, die Entwicklung des vergangenen
Jahrzehntes könnte auf eine neue Kultur der Offenheit und
Kompromissbereitschaft hinweisen.
Tom Segev beginnt mit einem sehr persönlichen Vorwort,
sehr persönlichen Erinnerungen. Segevs Vater war während der Nazi-Zeit
nach Palästina geflohen und fiel im Unabhängigkeitskrieg, sein Sohn war
damals erst drei Jahre alt. Jahr für Jahr erhielt die Familie am Jom
haSikharon, am Gedenktag für die Gefallenen, einen Brief des
Verteidigungsministeriums. Tom Segev erklärt mit dieser Erinnerung seine
grundsätzliche Skepsis gegen "regierungsamtliche Verlautbarungen", die
ideologieträchtig versicherten, "dass uns alle Kriege aufgezwungen
worden seien, dass das Opfer nicht umsonst gewesen sei und Israel alles
in seiner Macht Stehende tue, um Frieden zu schließen." Jene Skepsis
zeichne auch die so genannten "neuen Historiker" aus, die Segev
verschärft als "erste Historiker" bezeichnet.
In den 55 Jahren seit der Staatsgründung Israels haben
sich dramatische Veränderungen abgespielt und das Streben nach einer
"Normalisierung" des jüdischen Staates verkompliziert.
Masseneinwanderung, Kriege und wirtschaftliche Krisen stellen nur die
Eckpunkte der Umwälzungen in der Gesellschaft dar. Noch immer herrscht
Unklarheit über grundlegende Fragen, Werte und Normen, allen voran der
Dauerbrenner "Wer ist Jude?" Spätestens seit dem 50. Geburtstag des
Staates hat der Begriff "Postzionismus" Konjunktur, meistens in
negativer Verwendung, obwohl er zunächst nur das Zuendekommen einer
Periode zu bezeichnen sucht. Israel wurde in den vergangenen Jahrzehnten
zugleich amerikanischer und jüdischer und befindet sich in einer
Situation, "die vielfach als 'post-zionistische Entwicklungsphase'
bezeichnet wurde." Das Buch erzählt die "faszinierende Geschichte" der
Transformation und Veränderung des Zionismus.
Das Denkmal Theodor Herzls am Ortseingang von Herzlija
ist Segevs Ausgangspunkt. Herzls Silhouette steht dort mit verschränkten
Armen, im Frack, in die Ferne blickend. Geradezu bizarr wirkt der Mann
mit Vollbart hier, auch wenn er Namensgeber für die Stadt war. Der
Künstler Uri Lipschitz schuf das, was von Herzl blieb, nachdem er als
Identifikationsfigur auf Postern, Geldscheinen und Gebrauchsgegenständen
das Land überzogen hatte, eine Fassade. Der Prophet des Staates hätte
dabei an Herzlija sicher Gefallen gefunden, sein Denkmal blickt auf die
Hightech-Gebäude der Stadt, die sich schick, urban, westlich und
weltlich gibt – die Verwirklichung der Herzlschen Vision. Segev lässt
die Geschichte des Zionismus bis zur Gründung des Staates passieren und
geht dabei neben Herzls eigenen zionistischen Vorstellungen, die im
liberalen Nationalismus der Jahrhundertwende verwurzelt sind, vor allem
auf die tatsächliche Entwicklung in Palästina ein. Denn die meisten
Juden, die nach Palästina kamen, kamen nicht als überzeugte Zionisten,
sondern als Flüchtlinge. Segev weist dabei immer wieder auf Reaktionen,
Aussprüche und Tendenzen hin, die heute als "postzionistisch" geächtet
würden, jedoch bereits in den 20er, 30er und Anfangsjahren des Staates
kursierten: "Selbstkritik und Zweifel – einige mögen es "mangelnde
Vision" einhergehend mit Defätismus und Hoffnungslosigkeit nennen –
waren immer ein integraler Bestandteil der zionistischen Geschichte."
Die zweite Statue Segevs ist an einer Tankstelle in Newe
Ilan auf dem Weg nach Jerusalem zu finden. Elvis The Pelvis steht hier
überlebensgroß vor dem Imbiss: "Dieser Elvis signalisiert einen Sieg;
der Bolschewismus der frühen Ben-Gurion-Jahre war passe. Die Israelis
haben sich für Amerika entschieden." Die Amerikanisierung, so Segev, hat
langfristig die gesellschaftliche Solidarität geschwächt und das
Individuum ins Zentrum des israelischen Daseins gerückt. Während man
früher am Unabhängigkeitstag gemeinsam Hora auf der Strasse tanzte, wird
heute im Kreis der Freunde oder Familie dem Mangal (Barbecue) gefrönt.
Neben der politischen Annäherung an die USA, Israel versuchte sich
zunächst an den Fronten des Kalten Krieges vorbeizuschlängeln,
beschreibt Segev die Amerikanisierung in gesellschaftlicher und
kultureller Ebene. Der Aufstieg Bibi Netanjahus in der israelischen
Politik ist für Segev sowohl ein wichtiger Schritt wie auch Indikator
der Entwicklung: "Wie kein anderer Politiker vor ihm hat Benjamin
Netanjahu seine Karriere auf TV-Auftritten aufgebaut. Seine Wahl zum
Ministerpräsidenten steht daher nicht nur für die Amerikanisierung der
Politik, sondern markiert auch den Einzug Amerikas in die israelische
Medienlandschaft." Dem mag sich manch kritischer Zuschauer beim
vergangenen Unabhängigkeitstag schmerzlich bewusst geworden sein, als
man ein blondes Medienmäuschen im sexy Mini-Camouflage-Kleid eine
Fernsehgala der Armee mitmoderieren sah.
Eine Miniaturstatue von Rabbiner Ovadiah Josef, die in
einem Souvenirladen von Gush Etzion für 1000 Dollar zum Verkauf stand,
ist Segevs drittes Denkmal, das er zum Ausgangspunkt seiner Darstellung
über die Rolle des Judentums in der israelischen Gesellschaft nimmt. Der
vorstaatliche Jischuw schien die Basis für eine säkulare Gesellschaft
geschaffen zu haben, in den vergangenen Jahrzehnten wurde Israel jedoch
zunehmend jüdischer. Dabei spricht Segev nicht alleine die Entwicklung
der ultraorthodoxen und orthodoxen Bewegungen im Land an, sondern geht
vielmehr auch auf religiös motivierte Traditionen und deren
Wiederbelebung ein. Das beste Beispiel dafür ist das Mimouna-Fest der
marokkanischen Juden, das am Tag nach Pessach stattfindet und seit 1965
wieder gefeiert wird, mittlerweile hat es Volksfestcharakter mit
religiösem Hintergrund angenommen. Ein weiterer Schwerpunkt des Kapitels
ist die orthodoxe Einstellung zum Holocaust und der Umgang der
israelischen Gesellschaft im Allgemeinen mit der Schoah, wobei Segev
besonders auf das Erziehungssystem hinweist. Dabei gibt er zu Bedenken,
dass im Jahr 2000 etwa 35 Prozent alles israelischen Kinder keine
hebräisch-zionistische Schule besuchten: "Ungefähr ein Viertel alles
israelischen Kinder sind Araber. Weitere zwanzig Prozent werden an
Bildungseinrichtungen ausgebildet – vorwiegend ultra-orthodoxen -, die
nicht dem staatlichen Schulsystem unterstehen. Sie wachsen in einem
Staat auf, der mit dem zionistischen Traum nichts mehr zu tun hat."
Das letzte Denkmal ist das eines Soldaten aus dem Kibbuz,
Gadi Manella, der 1968 bei der Verfolgung von Terroristen ums Leben kam.
Die Bronzeskulptur von Nathan Rapaport steht an der Einfahrt zum Kibbuz
Tel Yitzhak. Segev geht abschließend dem Begriff des Patriotismus nach
und führt dazu unter anderem Yitzhak Rabin als Beispiel an. Rabin wurde
von vielen als Wegbereiter einer neuen Zukunft gesehen. Seine Ermordung
wurde "als Angriff auf ein apolitisches Israel, das kein kampfbereites
und kämpfendes Kollektiv mehr war" gedeutet. Patriotismus und Heldentum
ist für Segev auch Anlass, nochmals auf die Arbeiten und Ergebnisse der
"neuen Historiker" zurückzukommen und dieses Themenfeld an einigen
weniger bekannten Beispielen zu beleuchten. Zunächst geht Segev auf eine
Veröffentlichung von Yoram Hazony ein, der, nach Beratertätigkeiten für
Netanyahu, ein Institut in Jerusalem eröffnete und dort seine
revisionistische Geschichtsmaschinerie fördert. In "The Jewish State:
The Struggle for Israel's Soul" zieht Hazony mit linksgerichteten
Intellektuellen ins Gericht und beruft sich dabei scheinbar auf Herzl
selbst. Trotzdem dieses Buch in akademischen Kreisen einhellig negativ
kritisiert und abgelehnt wurde, hat es relativ viel Staub aufgewirbelt.
Ein andere Beispiel Segevs führt in den akademischen Bereich, einmal in
die mittelalterliche Geschichte und die Forschung von Israel Yuval, der
über jüdischen Christenhass im aschkenasischen Judentum arbeitete, sowie
in die Archäologie und zur Forschung Zeev Herzogs.
Abschließend gibt sich Segev nüchtern. Durch den
palästinensischen Terror habe der Postzionismus derzeit keine Chance.
Dennoch, tief greifende Entwicklungen haben bereits stattgefunden und
deuten daraufhin, dass eine Veränderung möglich ist. Derzeit wird vor
allem darüber gesprochen, wie Israel zugleich ein jüdischer und
demokratischer Staat sein kann: "Die post-zionistische Herausforderung
bedeutet, nach Wegen zu suchen, wie sich das Zusammenleben aller
Israelis unter Berücksichtigung der beiden großen Einflüsse auf das Land
– Amerika und Judentum – ermöglichen lassen. Die öffentliche Diskussion
darüber hat gerade erst begonnen."
hagalil.com 12-05-03 |