|
Signum der
Moderne:
Bilder jüdischer Bibliotheken
Andrea
Livnat
Jüdische Bibliotheken unterscheiden sich in ihrer Eigenschaft als
Kennzeichen der Moderne nicht von den Bibliotheken anderer
Lesekulturen. Sie setzen die gleiche Volksbildung und allgemeine
Leskundigkeit wie nicht-jüdische Bibliotheken voraus. Trotzdem
weisen sie bestimmte Eigenschaften und Besonderheiten auf, die eine
bibliotheksgeschichtliche Untersuchung besonders aufschlussreich und
fruchtbar machen. Textualität und Mobilität sind dabei die
wesentlichen Charakteristika der jüdischen Bibliotheken, wie sie
auch wesentliche Merkmale der jüdischen Geschichte im Allgemeinen
sind. Markus Kirchhoff hat die Geschichte der "Häuser des Buches" in
einem optisch sehr ansprechenden und informativen Band
zusammengestellt.
Der Band
basiert auf einer Ausstellung, die Markus Kirchhoff als Mitarbeiter
des Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur an der
Universität Leipzig unter dem Titel "Häuser des Buches - Leute des
Buches" gestaltet hat. Der Band, der die Ergebnisse seiner Arbeit zu
diesem Thema vorstellt, ist geschmackvoll gestaltet, unterstreicht
den Text durch zahlreiche Bilder, zeigt seltene Aufnahmen und
versucht grundsätzlich die mobile und migrationsgeschichtlicher
Perspektive begreifbar zu machen.
Kirchhoff
gibt einen Überblick zur jüdischen Bibliotheksgeschichte, der nicht
streng chronologisch vorgeht, sondern sich an einzelnen Orten und
Biographien orientiert. Ausgehend von der Lesewelt des Shtetls
spannt Kirchhoff den Bogen bis zur Restitution jüdischer
Bibliotheken nach 1945. Der besondere Wert und die Bedeutung des
Verleihens von Büchern lässt sich bis auf Textstellen im Talmud
zurückverfolgen, der Kauf und das Ausleihen von Büchern wird dort
als eine Form der Wohltätigkeit genannt, Bücher zu kaufen und für
sich alleine zu behalten dagegen strikt abgelehnt. "Wenn du Bücher
zu verkaufen hast und dein Bruder, der Bücher nicht ausleiht, sie
erwerben will, verkaufe sie lieber einem Fremden, der die Bücher
anderen ausleiht" heißt es in dem von Rabbi Judah haChassid
verfassten "Sefer Chassidim" aus dem frühen 13. Jahrhundert, eines
der Zitate, die Kirchhoff seiner Einleitung voranstellt.
Kirchhoff
behandelt die moderne Bibliothekskultur des Judentums von der Mitte
des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, die sich aus der
Tradition des Bücherleihens entwickelte und durch den Bruch der
Moderne, der Verweltlichung und Öffnung für nicht-sakrale Texte
geprägt ist. Die Vielfältigkeit jüdischer Bibliotheken, ihrer
Erscheinung, Hintergründe und Verwendungen spiegeln dabei die
Vielfältigkeit jüdischen Lebens selbst wieder.
Kirchhoff beginnt
seine Reise durch die jüdische Bibliotheksgeschichte mit der
Lesekultur im Shtetl, den fahrenden jüdischen Buchhändlern und der
Figur des Mendele Mojcher Sforim, eine Welt, die durch den Einbruch
der Haskalah-Literatur, die zunächst, wie in vielen Autobiographien
erinnert wird, heimlich gelesen werden musste, grundlegend
erschüttert wurde. Im Unterschied dazu etablierten sich in den
größeren Städten zunächst Buchhandlungen, die ärmeren Kunden auch
Bücher ausliehen, dann eigene Bibliotheken von verschiedenen
ideologischen Richtungen. Ein wichtiger Impuls zur Gründung von
Bibliotheken ging von der Arbeiterbewegung und den jüdischen
Sozialisten aus. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein Exkurs zu
Bibliotheken für jüdische Einwanderer aus Osteuropa in New York.

Eine Einladung, Mitglied einer Bibliothek zu
werden: Der Jiddische Dramatische Club Sh. An-ski wirbt mit
seiner Bibliothek, die bereits "über 3000 Bücher" enthalte und
ständig wachse. |
Der Einfluss
einzelner ideologischer Gruppen zeigt sich auch beim Blick auf
jüdische Bibliotheken in Polen zwischen den Weltkriegen, die vom
Entstehen eines politischen Bewusstseins geprägt waren. Vor allem
Jugendorganisationen jeder Art regten ihre Mitglieder zum
Selbststudium an, Bildung für eine bessere Zukunft war das Motto.
Diese Zeit kann als Blütezeit der jüdischen Bibliotheken in Polen,
wie auch des jüdischen Lebens in Polen allgemein angesehen werden.
Die jüdische Jugend war in den verschiedensten Gruppen organisiert,
die sich nach politischem Zionismus, Bund, internationalem
Sozialismus, Kulturzionismus oder nach Überschneidungen zwischen den
einzelnen Richtungen richteten. Eines war ihnen allen jedoch gemein,
sie alle hatten einzelne kleine Leseräume, kleine Bibliotheken. |
In den
Lebenserinnerungen von Borukh Yismakhs an seine Jugend in der Nähe
von Warschau heißt es: "Das kompetenteste Mitglied jeder Gruppe
wurde zum Bibliothekar ernannt. Wenn ein Leser ein Buch im Austausch
für ein anderes zurückgab, hatte der Bibliothekar das Recht ihn zu
testen, um zu sehen, ob er das Buch wirklich gelesen hatte, und wenn
ja, ob er es verstanden hatte."
Ein anderes
Kapitel führt den Leser aus Osteuropa zu einer völlig anderen Art
der Buchaufbewahrung, in die "Welt der Genisa", jenem Raum innerhalb
einer Synagoge, in dem alte Schriftstücke aufbewahrt wurden, die man
nach jüdischer Religion nicht wegwerfen kann, da auf ihnen der Name
Gottes steht. Die wichtigste Entdeckung einer Genisa war der
berühmte Fund in Kairo. Kirchhoff zeichnet den Weg Salomon
Schechters nach, der nach Kairo reiste und schließlich mit 140.000
Dokumenten nach England zurückkehrte. Aber auch andere Genisot
werden angesprochen, wie beispielsweise in Süddeutschland, die in
Vergessenheit gerieten und heute im Zuge der Erforschung der
Landjuden wieder entdeckt werden.
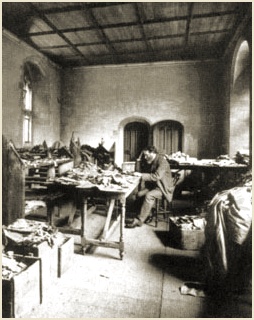
Solomon Schechter untersucht in Cambridge
Dokumente aus der Genisa von Kairo 1898
© Cambridge University Press |

Fund aus der ehemaligen Synagoge von Westheim
(Bayern). Das mit einer Schnur umwickelte und in der Genisa
abgelegte Bündel enthält Kalender aus den Jahren 1764 und 1766,
Teile von zerlesenen Gebetsbüchern und ein Papierfragment aus
einem Geburtenverzeichnis des Jahres 1776.
Foto: Andreas Hemstege, Wesel |
Ein
Ortswechsel führt nach Israel, in die Zeit vor der
Staatsgründung, in der die verschiedenen Bibliothekstraditionen
scheinbar verschmolzen, dabei zeigt sich jedoch, dass die
deutsche Tradition erstaunlich dominant war. Kirchhoff zeigt den
Einfluss einzelner Personen auf das Bibliothekssystem des Landes
anhand deren Biographien, wie beispielsweise Heinrich Loewes,
der bereits 1922 die pragmatische Schrift "Jüdisches
Bibliothekswesen im Lande Israel" verfasste. In Deutschland war
er als Leiter der Orientalia-Abteilung an der Berliner
Universitätsbibliothek beschäftigt, musste diese Stellung jedoch
1933 aufgeben und kam nach Palästina. Dort leitete er von 1933
bis 1948 die Stadtbibliotheken Tel Avivs, die aus einer 1884 in
Jaffa von der Bnai Brith Loge gegründeten Bücherei hervorgingen.
|
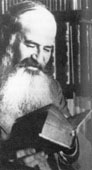
Heinrich Loewe, der von 1933 bis 1948 die Tel
Aviver Stadtbibliotheken leitete. |
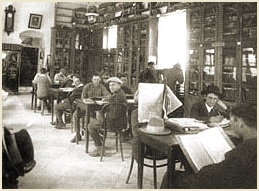
Lesesaal im Beit Ne'eman. Die Bibliothek des 1902
in der Ethopia Street in Jerusalem eröffneten Hauses galt
bereits als Kern der zukünftigen Jüdischen Nationalbibliothek.
Foto: Z. Bassan. |
Generell
verstärkte sich der deutsche Einfluss auf das Bibliothekswesen
in Palästina maßgeblich nach 1933 und der Einwanderung deutscher
Buchexperten. Auch die Geschichte der Jüdischen National- und
Universitätsbibliothek, deren erster Direktor Hugo Shmuel
Bergmann zuvor an der deutschsprachigen Karlsuniversität in Prag
beschäftigt war, ist durch das deutsche Bibliothekssystem
geprägt. Bergmann baute die Sammlungen entsprechend auf und fand
für die einzelnen Bereiche Spezialisten. |
Für die
Hebraica Sammlung konnte er den junge Gershom Sholem gewinnen. Auch
der zweite Direktor war ein Deutscher, Gotthold Weil, der seine
Stellung in der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin verlor, ab
1949 übernahm die Position der ebenfalls aus Deutschland stammende
Curt Wormann.
Es wurde vielfach
kritisch angemerkt, dass das dadurch entstandene Bibliothekswesen zu
starr war, um schnell genug auf die Bedürfnisse der Neueinwanderer
und die Anforderungen im Zuge der Masseneinwanderung in den Jahren
nach der Staatsgründung zu antworten. Dabei sollte jedoch zwischen
den einzelnen Bibliotheken und ihrem Zweck differenziert werden. Für
die für das breite Publikum gedachten Stadtbibliotheken Tel Avivs
mag das mehr als zutreffend sein, die National- und
Universitätsbibliothek musste jedoch an den internationalen
wissenschaftlichen Standard anschließen.
Mit einem
erneuten Wechsel führt Kirchhoff den Leser zurück nach Deutschland
zu den urbanen Lesewelten in Berlin und zeigt das ganze Panorama der
jüdischen Bibliotheken der Stadt, von der Bibliothek der Hochschule
für die Wissenschaft des Judentums, über die Jüdische Lesehalle,
religiöse Sammlungen, bis zu weltlichen Buchläden und nach 1920 auch
orthodoxe Leihbüchereien im Scheunenviertel. Als Beispiel sei die
Jüdische Lesehalle mit ihrer Bibliothek erwähnt, die in Verbindung
mit der sog. Bücherhallenbewegung entstand. Die erste jüdische
Lesehalle wurde 1895 von Studenten und einigen Vereinen gegründet,
wobei das Ziel nicht nur die Förderung allgemeiner Bildung, sondern
"eine wahre Stärkung im Kampf gegen die andrängenden Feinde", also
Bildung zur Abwehr des Antisemitismus war. Daher fanden auch
Geschichtskurse und Hebräischunterricht in der Lesehalle statt. 1920
wurde sie von der Jüdischen Gemeinde übernommen und bildete den
Grundstock der ersten Stadtteilbibliothek der Gemeinde.
In der Jüdischen Lesehalle, Berlin, 1905.
 |

In der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde
Berlin. Foto: Abraham Pisarek, ca. 1935. |
In diesem
Zusammenhang weist Kirchhoff auf ein interessantes Detail in der
Landschaft der Berliner jüdischen Bibliotheken hin. Halb im Geheimen
entstand ein Archiv mit Bibliothek gegen den Antisemitismus, das
sog. "Büro Wilhelmstraße". Später auch mit dem Centralverein
verbunden, wurde dort alle greifbare NS-Literatur und Presse
gesammelt. Die Sammlung emigrierte später nach Amsterdam und London
und stellt die Grundlage der berühmten Wiener Library, deren
Geschichte Kirchhoff an anderer Stelle ausführlicher nachzeichnet.
In einem weiteren
Kapitel zu deutsch-jüdischen Bibliotheken unter dem Titel
"Bibliophilie als Selbstbehauptung" stellt Kirchhoff weitere
Buchsammlungen vor, die besondere Projekte darstellen;
beispielsweise die Warburg Bibliothek, die unter anderem den
Gelehrten der sog. Hamburger Gruppe, darunter Ernst Cassirer und Aby
Warburg selbst, als Arbeitsgrundlage diente, sowie die Bücherei des
Schocken Verlags.
 Buch
eines unbekannten Vorbesitzers mit dem Stempel der Zentralbibliothek
des Ghettos Theresienstadt. Buch
eines unbekannten Vorbesitzers mit dem Stempel der Zentralbibliothek
des Ghettos Theresienstadt.
Die letzten
beiden Kapitel beschäftigen sich mit der Geschichte jüdischer
Bibliotheken vor und während der Schoah bzw. mit der Restitution der
Bücher. Kirchhoff stellt einzelne Fälle der Zerstörung von
Bibliotheken, den Raub von Büchern, wie in Saloniki und Wilna, aber
auch das Institut zur Erforschung der Judenfrage dar. An den
Beispielen Warschau, Wilna und Theresienstadt spricht er zudem das
Bestehen von Bibliotheken in den Ghettos an. An eine knappe
Darstellung der Restitution nach 1945 schließt Kirchhoff zum
Abschluss das Paradebeispiel einer migrierten Bibliothek an, die
bereits erwähnte Wiener Library, die von Berlin nach Amsterdam, nach
London und schließlich nach Tel Aviv wanderte und heute gleichzeitig
in London und Tel
Aviv
existiert.
Kirchhoffs
Überblick zeigt, dass die jüdische Bibliotheksgeschichte durchaus
als Migrationsgeschichte begriffen werden kann, Millionen von
Büchern wechselten vor allem im 20. Jahrhundert ihren Standort.
Jüdische Bibliotheken sind aufs Vielfältigste migriert, nicht nur
wegen der Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Schoah. Die
Mobilität jüdischer Bücher hat eine ebenso lange Tradition wie das
Ausleihen von Büchern selbst. Schade, dass Kirchhoff die Geschichte
der jüdischen Bibliotheken nach der Restitution von 1945 abbricht,
zumindest ein Ausblick in die zweite Hälfte des Jahrhunderts wäre
eine wertvolle Ergänzung.
Eine Genisah in Nordbayern?
Das
wiedergefundene Buch
Nicht mehr benutzbare rituelle Gegenstände
oder Bücher auf den Dachboden der Synagoge abzulegen, war unter
deutschen Landjuden ein selbstverständlich ausgeübter Brauch...
hagalil.com
13-03-05 |