Kladovo:
Eine Flucht nach Palästina
Jüdisches Museum Wien
Von 8. Juli bis 4. November 2001 zeigte das Jüdische Museum
Wien "Kladovo – Eine Flucht nach Palästina", die das Schicksal einer Gruppe
jüdischer Flüchtlinge dokumentierte, die unter besonders dramatischen
Umständen stattfand: Im Dezember 1939 verließ ein Schiff mit über 1000
Flüchtlingen an Bord den Hafen von Bratislava. Zum Großteil waren sie per
Bahn aus Wien gekommen. Nach zweiwöchiger Odyssee auf der Donau erreichte
die Gruppe den serbischen Ort Kladovo. Alle Bemühungen um eine Weiterreise
scheiterten zunächst am strengen Winter, der den Fluss zufrieren ließ, dann
aber an finanziellen, organisatorischen und vor allem behördlichen
Schwierigkeiten. Nur etwa 200 Jugendlichen gelang wenige Tage vor dem
Nazi-Überfall auf Jugoslawien im April 1941 doch noch die Flucht nach
Palästina.
Ehud Nahir
zählte zu den Überlebenden. Er stellte Hunderte Fotos, die den Weg in die
Lager von Kladovo und Šabac dokumentieren, zu dem Album zusammen, das den
Ausgangspunkt für die Ausstellung bildet. Hinzu kommen Originaldokumente und
ein Film von Alisa Douer, in dem der Lebensweg von Überlebenden des
Kladowo-Transportes nachgezeichnet wird. Ein zweisprachiges Begleitbuch zur
Ausstellung ist im Mandelbaum Verlag Wien erschienen.
Der
Kladovo-Transport
Die
Vertreibung der jüdischen Bevölkerung gehörte seit 1933, verstärkt aber nach
dem "Anschluss" Österreichs, zu den zentralen Zielen der
nationalsozialistischen Machthaber. Doch schon im Oktober 1939 fanden erste
Deportationen aus Wien in das deutsch besetzte Polen statt. Parallel zu
dieser neuen Linie in der antijüdischen Politik wurde die jüdische
Auswanderung aus dem "Reich" aber noch 1940 weiter forciert und erst im
Herbst 1941 offiziell verboten. Die "freie Welt" hatte in dieser Situation
ihre Tore vor den anströmenden Flüchtlingsmassen immer rigoroser
verschlossen, sodass vor allem nach Kriegsbeginn fast nur noch die Flucht in
einige überseeische Länder oder aber mit sogenannten "illegalen Transporten"
nach Palästina in Frage kam. Diese Transporte, mit denen Juden unter
Missachtung der britischen Einwanderungsbeschränkungen in das britische
Mandatsgebiet im Nahen Osten geschleust wurden, wurden seit Mitte 1938 zu
einem Massenrettungsprogramm. Sie gewannen 1939 weiter an Bedeutung, weil
die Briten die legale Einwanderung nach Palästina im Mai durch das
"Weißbuch" weitgehend eingefroren und nach Kriegsbeginn die direkte
Immigration von Juden aus dem "Deutschen Reich" gänzlich untersagt hatten.
Juden aus diesen Gebieten galten fortan als "feindliche Ausländer. Nur wer
sich bereits in einem neutralen Land befand, konnte unter bestimmten
Bedingungen ein Einwanderungszertifikat bekommen.
Die immer
dramatischere Verfolgungssituation in der "Ostmark", vor allem die Androhung
neuerlicher Deportationen durch die SS, veranlassten den damaligen
Generalsekretär des "Hechaluz" und "Mossad"-Repräsentanten in Wien, Georg
Überall (später Ehud Avriel) gegen Ende des Jahres 1939 zu einer
folgenschweren Entscheidung: Er beschloss, die noch in der "Ostmark"
befindlichen Mitglieder des "Hechaluz" außer Landes zu bringen, obwohl an
der unteren Donau kein Hochseedampfer für ihren Weitertransport nach
Palästina bereit stand. Erstmals wurde in dieser Situation auch eine etwa
120 Personen umfassende Gruppe der "Jugend-Alija" (JUAL) einem illegalen
Transport angeschlossen. Mehrere Hundert Personen wurden zunächst nach
Bratislava gebracht. Gemäß einer Aufstellung hatten sich zunächst 822
Personen aus Wien, 130 aus Berlin und 50 aus Danzig dem Transport
angeschlossen. Während des Aufenthaltes in Bratislava kamen noch etwa 100
weitere Flüchtlinge aus Prag und Bratislava hinzu.

Wien, Schloss Schönbrunn,
25. November 1939, Rathaus
Weil die
Donau zuzufrieren drohte und die slowakischen Behörden die Rückstellung der
Gruppe an die deutsche Grenze ankündigten, drängten die "Mossad"-Agenten in
Wien und Genf, Georg Überall und Mosche Agami, auf die Weiterfahrt, obwohl
an der Donaumündung noch immer kein Schiff bereit stand. Nach etwa
zehntägigem Aufenthalt fuhren die Flüchtlinge auf der "Uranus", einem mit
Hakenkreuzfahnen beflaggten Ausflugsdampfer der DDSG, von Bratislava ab.
Doch bereits an der ungarischen Grenze wurde das Schiff unerwartet
aufgehalten und musste zum Ausgangsort zurückkehren. Am 13. Dezember begann
die Reise noch einmal, doch schon einen Tag später wurden die Passagiere
mitten auf dem Fluss auf drei jugoslawische Ausflugsschiffe – "Car Nikola",
"Car Dušan" und "Kraljica Marija" – transferiert, die der Generalsekretär
des Verbandes der jüdischen Gemeinden in Jugoslawien, Sime Spitzer, im
Auftrag des "Mossad" von der nationalen jugoslawischen
Schifffahrtsgesellschaft gechartert hatte. Ursache der unerwarteten Wendung
war die Weigerung der DDSG, die Fahrt mit der "Uranus" fortzusetzen, solange
die Umschiffung der Passagiere an der Donaumündung nicht gesichert war.
Doch auch
die Reise auf den jugoslawischen Schiffen endete wenig später – diesmal im
Dreiländereck zwischen Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien. Nun hatten die
Rumänen mit dem selben Argument die Durchfahrt untersagt. Bald darauf wurde
klar, dass aufgrund der Witterungsbedingungen mit einem Fortkommen in
absehbarer Zeit nicht mehr zu rechnen war. Am Silvestertag des Jahres 1939
wurden die Schiffe in den Winterhafen von Kladovo nahe dem Eisernen Tor
eingewiesen. In diesem kleinen Ort, der 54 Kilometer von der nächsten
Eisenbahnstation entfernt und im Winter praktisch von der Außenwelt
abgeschnitten war, sollten die Flüchtlinge die Eisschmelze abwarten. Spitzer
musste sich gegenüber der jugoslawischen Regierung verpflichten, für die
Erhaltung der Gruppe aufzukommen. In ganz Jugoslawien lebten zu dieser Zeit
neben 71.200 einheimischen Juden bereits Tausende Flüchtlinge aus
Deutschland und Österreich, für die eigene Sammellager eingerichtet worden
waren.
Auf den
Schiffen herrschten unerträgliche Zustände: räumliche Beengtheit, Schmutz
und klirrende Kälte. Erst nach einigen Wochen erhielten die Flüchtlinge die
Erlaubnis zu zeitlich begrenzten Aufenthalten am Ufer. Nach weiteren Wochen
drängte die Schifffahrtsgesellschaft auf die Räumung der drei Dampfer, und
die Flüchtlinge übersiedelten an Land – teils in den Ort, teils in Baracken-
und Zeltlager am Ufer. Im Zelt- und im Barackenlager, die sich in der Nähe
großer Sümpfe befanden, grassierte bald die Malaria, und wegen der
unzureichenden Ernährung, dem Schmutz und dem Ungeziefer breiteten sich
Krätze und Furunkulosen aus; vereinzelt traten auch Fälle von Kinderlähmung,
Rotlauf und Typhus auf.
Im
September 1940 konnte die Flüchtlingsgruppe Kladovo endlich verlassen. Doch
die Reise führte nicht wie erwartet in Richtung Donaudelta, sondern einige
Hundert Kilometer zurück, stromaufwärts, in das serbische Städtchen Sabac an
der Save. Die Verlegung der Gruppe stand in Zusammenhang mit einer großen,
von der SS geleiteten Aktion zur Rücksiedlung von Volksdeutschen aus
Rumänien, die – ebenfalls mit Dampfern der DDSG – flussaufwärts befördert
und vorübergehend in Auffanglagern in den serbischen Ortschaften Kladovo und
Prahovo untergebracht wurden.
Am 22.
September 1940 trafen die Flüchtlinge in dem kleinen Städtchen Šabac ein.
Dort wurden die älteren Menschen und Ehepaare in Privatzimmern, die
Jugendlichen großteils in einer aufgelassenen Getreidemühle einquartiert,
die für diesen Zweck adaptiert wurde. Die Flüchtlinge durften sich mit
bestimmten Beschränkungen frei in der Stadt bewegen. Mit der Übersiedlung
nach Šabac verbesserten sich die Lebensbedingungen der
Flüchtlingsgemeinschaft. Die Menschen genossen größere Bewegungsfreiheit,
und es kam mehr Ordnung in ihr Leben. Große Bedeutung kam den verschiedenen
zionistischen Jugendgruppen zu, die ihren Mitgliedern durch die Einbindung
in ein straffes soziales Gefüge, strikte Disziplin und einen genau
geregelten Tagesablauf seelischen Halt zu vermitteln suchten. Obwohl
offiziell verboten, suchten viele nach Beschäftigungsmöglichkeiten bei der
ortsansässigen Bevölkerung, um sich etwas Taschengeld zu verdienen. Trotz
dieser Erleichterungen lebten die Flüchtlinge weiterhin auf Abruf: Viele
Male wurde der Aufbruch angekündigt, alles gepackt und vorbereitet.
In Šabac
wurde in den letzten Monaten vor dem deutschen Überfall auf Jugoslawien die
Kriegsbedrohung immer deutlicher spürbar. Doch noch immer strömten
Flüchtlinge aus dem "Deutschen Reich" über die Grenze – auch nach Šabac, wo
sich die Flüchtlingsgemeinschaft auf geschätzte 1.400 Menschen vergrößerte.
In letzter Sekunde vor dem deutschen Überfall konnte ein kleiner Teil der
Kladovo-Flüchtlinge doch noch mit Zertifikaten nach Palästina entkommen,
wobei die Zahlenangaben zwischen 200 und 280 Personen schwanken. Es handelte
sich bei den Geretteten zum überwiegenden Teil um Mitglieder der
"Jugend-Alija", also die 15- bis 17jährigen. Zusätzlich konnten noch einige
erwachsene Betreuer, eine Anzahl älterer Mädchen mit WIZO-Zertifikaten sowie
eine kleine Zahl älterer Menschen entkommen, für die Verwandte in Palästina
Bürgschaften übernommen hatten.

Trude März 1941
Als die
Wehrmacht in Jugoslawien einmarschierte, blieben die restlichen mehr als
1100 jüdischen Flüchtlinge des Kladovo-Transportes in der serbischen Stadt
Šabac. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 begann der
Massenmord an den Juden im Osten. Für die Kladovo-Gruppe bedeuteten diese
Entwicklungen, dass sie ab Sommer 1941 keine Chance mehr hatte, Serbien zu
verlassen. Von jenen Kladovo-Flüchtlingen, die sich zum Zeitpunkt des
deutschen Überfalls auf Jugoslawien im April 1941 noch immer in Serbien
befanden hatten, war es in den darauffolgenden Wochen nur einer Handvoll
gelungen, doch noch den Nationalsozialisten zu entkommen und so den Krieg zu
überleben.
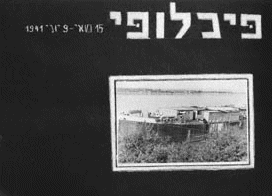
Penelope 15. Mai-9. Juni 1941
Als Anfang
Oktober 1941 bei einem Gefecht mit Partisanen 21 Soldaten getötet wurden,
ordnete General Böhme an, zur "Sühne" im Verhältnis 1: 100 für jeden
getöteten Deutschen insgesamt 2100 Menschen, "vorwiegend Juden und
Kommunisten", zu erschießen. Zu den Opfern dieser "Sühneaktion" zählten 805
Juden, Sinti und Roma aus dem Lager in Šabac - unter ihnen alle Männer des
Kladovo-Transportes. Im Jänner 1942 wurden die Frauen und Kinder des
Kladovo-Transportes in das KZ Sajmiste bei Belgrad überstellt, wo bereits
die aus Serbien stammenden jüdischen Frauen und Kinder interniert waren.
Dieses ehemalige Messegelände war nicht als Lager adaptiert. So vegetierten
mehr als 7000 Frauen, darunter Greisinnen, Kinder, und Säuglinge bei eisiger
Kälte in den Baracken. Viele von ihnen erfroren oder starben an
Unterernährung, die anderen wurden mit den Abgasen von Transport-LKWs
ermordet.
Erst nach
Kriegsende wurde die tragische Geschichte der in Serbien zurückgebliebenen
Mitglieder des Kladovo-Transportes in Umrissen bekannt. Bis heute sind
manche Angehörige nicht im Detail darüber informiert, auf welche Weise ihre
Verwandten in Serbien ums Leben gekommen sind.
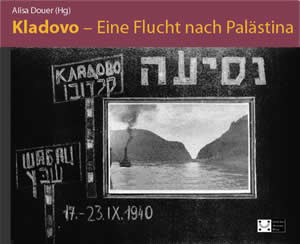
Alisa Douer (Hg.): Kladovo - Eine Flucht nach Palästina
Mandelbaum Verlag 2001
Euro 14,00
Bestellen?
hagalil.com
22-04-03 |