Alles ist erleuchtet
Der amerikanische Autor Jonathan Safran Foer kam zur Lesereise nach
Deutschland
Franziska Werners
Selten haben sich Kritikerstimmen derart unisono
überschlagen, was ihre Lobeshymnen auf den eben in deutscher Übersetzung
erschienenen Roman eines jungen Amerikaners betrifft: "Everything is
illuminated" zu deutsch "Alles ist erleuchtet" begeistert diesseits wie
jenseits des Atlantiks das Publikum.
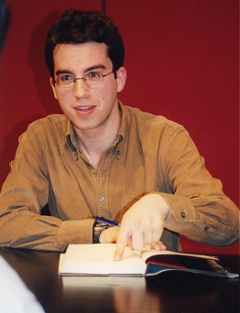
 |
Die Geschichte mit der Widmung »Schlicht
und unmöglich – für meine Familie« ist zum Teil die des jüdischen Autors
Jonathan Safran Foer selbst. Geboren 1977 unternahm er knapp
zwanzigjährig eine Reise in die Ukraine, um eine Frau zu finden, die
angeblich seinen Großvater vor den Nazis gerettet hatte. Die Reise
verlief ergebnislos - zunächst jedenfalls, bis Safran Foer begann, über
eben diese Suche zu schreiben und sie damit gewissermaßen neu zu
erfinden.
»Manchmal muß man sich weit von der Wahrheit entfernen,
um die Wahrheit zu finden« erklärte Safran Foer bei einer Lesung in
München.
So ähnlich mag auch jener SPIEGEL-Journalist gedacht haben, der den
jungen Autor in einem kürzlich erschienenen Portrait darstellte, als
habe dieser sich von seinen Buchtantiemen als erstes ein Haus und eine
japanische Limousine geleistet. Der Moderator der Münchner Lesung,
Richard Chaim Schneider, selbst Autor und Filmemacher, nutzte die
Gelegenheit, diese Legende zurechtzustutzen. Das Haus, so Schneider, sei
nur für den Sommer gemietet worden und das Auto hatte Safran Foer sich
kurzfristig von einem Freund geborgt.
Jonathan Safran Foer
in München
Fotos fw
[Bestellen?]
[Order?]
Doch zurück zur Wahrheit im Buch oder besser, zu den
verschiedenen Wahrheiten. |
Da ist zunächst die Version des ebenfalls
1977 geborenen Ukrainers Alexander Perchow, genannt Alex. Aufgewachsen in
bescheidenen Verhältnissen und mit mäßiger Schulbildung erscheint er
zunächst als jugendlich-chauvinistischer Angeber: »ich habe mich immer als
sehr stark und potent gefunden. Ich habe viele, viele Freundinnen, das
können Sie mir glauben.« heißt es gleich auf der ersten Seite, und die
holperige Sprache des Ich-Erzählers ist nicht etwa ein Versehen des
Übersetzers. Safran Foer läßt Alex nicht in seiner Muttersprache berichten,
sondern in einem reichlich fehlerhaften und dadurch unfreiwillig komischen
Englisch, das der Übersetzer Dirk van Gunsteren meisterhaft in ein
verdrehtes Deutsch übertragen hat, und weil das so schön ist, hier noch eine
Kostprobe:
»Vater schuftet für ein Reisebüro, das Heritage Touring getauft ist. Es ist
für Juden wie den Helden, die danach sehnen, das erhabene Land Amerika zu
verlassen und bescheidene Dörfer in Polen und der Ukraine zu besuchen.
Vaters Reisebüro beschafft einen Übersetzer, einen Führer und einen Fahrer
für die Juden, die versuchen, die Plätze auszugraben, wo ihre Familien
früher gelebt haben. Okay, bis zu dieser Reise hatte ich nie einen Juden
kennen gelernt. Aber das war ihr Fehler, nicht meiner, denn ich war immer
bereit - man könnte sogar schreiben: ich glühte darauf - , einen kennen zu
lernen. Ich will auch diesmal wahrheitlich sein und erwähnen, dass ich vor
der Reise vorgestellt hatte, dass Juden Scheiße zwischen den Ohren haben.
Das liegt daran, dass ich von Juden nur wusste, dass sie Vater viel Geld
dafür bezahlen, um im Urlaub von Amerika in die Ukraine zu fahren. Aber dann
habe ich Jonathan Safran Foer kennen gelernt, und ich kann Ihnen sagen: Er
hat keine Scheiße zwischen den Ohren. Er ist ein genialer Jude.«
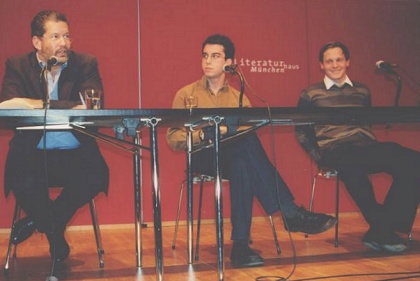
Und ein genialer Autor ist er auch, wie er
sich da namentlich so unvermittelt ins Spiel bringt. Ein gewisser Jonathan
Safran Foer also, »der Held«, wie Alex ihn oft nennt, kommt in die Ukraine,
um Augustine zu finden, die seinen Großvater vor den Nazis rettete, und
Trachimbrod, jenen Ort, in dem der Großvater einst gelebt haben soll. Alex
wird sein Dolmetscher und Alex‘ Großvater, ein depressiver alter Mann, der
sich seit dem Tod seiner Frau für blind hält, der Fahrer. Begleitet werden
sie außerdem von der »amtlichen Blindenhündin« Sammy Davis jr. jr., die
sogleich mit dem amerikanischen Touristen Freundschaft schließen will. Doch
der Held hat Angst vor Hunden, ist außerdem auch noch Vegetarier und stellt
viele Fragen ...
Was vordergründig wie ein amüsanter Schelmenroman beginnt, erweist sich bald
als eine komisch-traurige, naiv-intelligente Zeitreise in versunkene Welten.
Safran Foer entwirft eine furiose Familien- und Schtetl-Chronik beginnend
1791 als seine Ur-ur-ur-ur-ur- Großmutter im Babyalter durch einen Unfall
die Eltern verliert und ein bis dahin anonymer Ort durch Losverfahren seinen
Namen erhält: Trachimbrod. Die Chronik endet gut 150 Jahre später mit der
Zerstörung Trachimbrods durch die Nazis.
Safran Foers ebenso phantasie- wie humorvolle Schilderung der Ereignisse in
und um Trachimbrod durchbricht und ergänzt Alex‘ Reisebericht und ist
ihrerseits Gegenstand eines Dialogs, den Alex und der Held nach Beendigung
ihrer Reise in Briefform fortführen. Während die Briefe Safran Foers im
„OFF“ bleiben, ihr Inhalt sich also höchstens an Alex‘ Antworten ablesen
läßt, werden dessen Briefkommentare in ganzer Länge wiedergegeben, wodurch
sich die dritte Ebene des Romangeschehens eröffnet.
Die Verknüpfung dieser stilistisch höchst unterschiedlichen Erzählebenen,
von Alex‘ Reisebericht über seine späteren Briefe an den Helden bis zu
Safran Foers Geschichte Trachimbrods und seiner Einwohner, ist ein
literarisches Meisterstück.
Wie Trachimbrod scheinbar unausweichlich seinem Untergang entgegengeht, so
kann auch Alex‘ Großvater den Erinnerungen an die Vergangenheit nicht
entkommen. Schon nach weniger als einem Drittel des Romans - die
Protagonisten stehen noch am Beginn ihrer Reise - berichtet Alex von einer
schlaflosen Nacht, die er und sein Großvater in einem Hotel verbringen: »Ich
hörte sein großes Atmen. Ich hörte seinen Körper sich bewegen. So war es die
ganze Nacht. Ich wußte, warum er nicht ruhen konnte. Es war derselbe Grund,
warum ich auch nicht ruhen konnte. Wir dachten beide an dieselbe Frage: Was
hatte er im Krieg getan?«
Alex Berichte werden zunehmend ernster und
auch er selbst durchläuft einen spürbaren Reifeprozeß je weiter sie auf
ihrer Reise in die Vergangenheit vordringen und je mehr er sich mit der
Verstrickung des Großvaters in die Kriegsereignisse auseinanderzusetzen
beginnt.
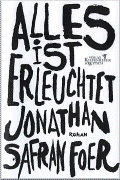
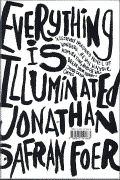
[Bestellen?]
[Order?] |
So witzig und humorvoll sich viele
Passagen dieses Romans einerseits lesen, es ist, wie der Autor
nachdrücklich betont, keine Komödie über den Holocaust, so wenig wie der
Holocaust das Hauptthema des Romans ist, womit Safran Foer indirekt auf
vereinzelte Kritik in Amerika anspielt, die ihm vorhielt, er mache Witze
über den Holocaust.
Eher trifft zu, was Alex in einem seiner Briefe formuliert, wonach
»humorvoll die einzig wahrheitliche Art ist, eine traurige Geschichte zu
erzählen«.
Es sind nicht zuletzt solche Sätze, die einen erstaunt innehalten lassen
und man fragt sich, wie es sein kann, daß ein so junger Autor derartiges
zu formulieren im Stande ist. Auch Richard Chaim Schneider, dem die
ehrliche Begeisterung für den Roman und seinen höchst sympathischen
Autor anzumerken ist, stellt diese Frage. »Vielleicht ist es eher
einfacher, wenn man jünger ist« antwortet »der Held« gelassen. »Je älter
man wird, desto mehr weiß man. Das macht es schwerer, Entscheidungen zu
fällen. Dabei sollte man es eher machen wie Kinder. Im Alter denkt man
oft zu viel nach.«
Bleibt zu hoffen, daß Jonathan Safran Foer sich diese jugendliche
Unbekümmertheit noch lange bewahren kann.
Das Publikum im Münchner Literaturhaus schenkte ihm, aber auch dem etwa
gleichaltrigen Schauspieler Johannes Zirner, der sich während der Lesung
als ausgezeichneter Interpret der deutschen Übersetzung erwies, einen
ebenso berechtigten wie herzlichen Applaus. |
Franziska Werners -
hagalil.com
24-03-03 |