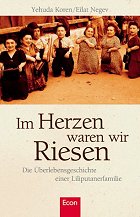
Yehuda Koren, Eilat Negev:
Im Herzen waren wir Riesen. Die Überlebens-geschichte einer
Liliputanerfamilie
Econ Verlag 2003
Euro 22,00
Bestellen? |
"Wir waren vielleicht die einzige
Großfamilie, die ein Todeslager gemeinsam überstanden hat. Wenn ich ein
junges jüdisches Mädchen von 1,70 gewesen wäre, hätte ich Auschwitz
nicht überlebt; ich wäre ins Gas gegangen, wie Millionen andere. Wenn
ich also ab und an mit mir hadere und mir die Frage nach dem Sinn meiner
Kleinwüchsigkeit stelle, dann muss meine Antwort eigentlich lauten: Das
war Gottes Weg, mich am Leben zu halten." Diese Worte von Perla Ovitz
fassen eine beeindruckende und bewegende Lebensgeschichte zusammen. "Im
Herzen waren wir Riesen" erzählt die außergewöhnliche
Überlebensgeschichte der Familie Ovitz, einer aus Transsylvanien
stammenden jüdischen Familie. Das Buch ist
in jedem Fall, wie es in fast allen Rezensionen zu lesen war,
beeindruckend. Das liegt vor allem an der ungewöhnlichen Geschichte, die
es erzählt. Die Autoren hatten das besondere Glück, Perla Ovitz noch
persönlich kennen zu lernen und so ihre Erinnerungen zu hören. Es hätte
also ein wirklich außergewöhnliches Buch werden können. Im Klappentext
heißt es, die beiden Autoren, Yehuda Koren und Eilat Negev, schreiben
für Israels wichtigste Tageszeitung Yedioth Achronoth. Eigentlich
sollten hier schon alle Alarmglocken schrillen, denn die Definition von
"wichtig" ist hier irreführend. Yedioth kann man guten Gewissens mit der
Bild-Zeitung vergleichen, und im entsprechenden Stil ist leider auch das
Buch geschrieben.
Doch zunächst zum Inhalt. Die Geschichte beginnt 1868
mit der Geburt des kleinwüchsigen Shimshon Ovitz. Er selbst gründete
später eine Familie und wurde Vater von zehn Kindern, sieben davon
ebenfalls kleinwüchsig. Shimshon zog zunächst als Unterhalter auf
Hochzeiten durch die Landen und wurde schließlich als Wanderrabbiner
bekannt. Als er 1923 an einer Fischvergiftung starb, blieb die Familie
alleine zurück. Avram, der älteste Sohn, trat in die Fußstapfen des
Vaters. Bald organisierte sich die Familie neu, tourte durch die Gegend,
trat auf Lokalbühnen auf, musizierte und sang. Die Autoren schreiben
über den Alltag der Familie, der durch die Kleinwüchsigkeit der sieben
Geschwister geprägt war. Im Hause Ovitz war der Familienzusammenhalt
besonders fest und auch nachdem einige der Schwestern heirateten,
blieben sie bei der Familie und die angeheirateten Männer zogen mit ein.
Die "großen" Familienmitglieder halfen stets bei dem, was für die
"kleinen" nicht machbar war. Die Familie Ovitz bewohnte ein schönes
großes Haus in der Ortschaft Rozavlea, fuhr auf Tourneen und lebte in
relativem Wohlstand. Sie besaß das erste Auto im Ort. Diesen ersten Teil
der Geschichte umranden die Autoren mit allgemeinen Berichten über
kleinwüchsige Musiker und Showstars, bringen Beispiele aus den USA,
Deutschland und anderen europäischen Länder.
Die Familie Ovitz blieb relativ lange von den
Verfolgungen durch das nationalsozialistische Deutschland verschont.
Durch einen Zufall fehlte der Judenstempel in den Pässen der Ovitzens
und sie konnten weiterhin auf ihre Konzertreisen gehen. Schließlich
erreichte das Naziregime jedoch auch Ungarn. Die Familie Ovitz wurde
deportiert. Fotographien, die in Zeitungen abgelichtet wurden,
unterschrieben mit "Jüdische Zwerge im Ghetto", zeugen von diesem Tag.
Das Buch zeichnet den beschwerlichen Weg nach, der schließlich mit der
Ankunft im Mai 1944 in Auschwitz endet. Die Familie wurde bereits an der
Rampe ausgesondert, Dr. Mengele herbeigeholt. "Arbeit für 20 Jahre",
freute er sich. Da Mengele an der Vererbung der Kleinwüchsigkeit
interessiert war, sorgte er dafür, dass die gesamte Familie zusammen
blieb. Den Ovitzens gelang es auch die Familie Slomowitz, der Vater
hatte als Fahrer für die Ovitz-Familie gearbeitet, zu schützen, indem
sie sie ebenfalls zu Verwandten titulierten.
Die Familie durchlebte eine qualvolle Zeit in
Auschwitz, eine Zeit als lebendige Versuchsobjekte. Sie erhielten einige
besondere Privilegien, ohne die die kleinwüchsigen Mitglieder der
Familie nicht überlebt hätten. Das war Mengele klar, und so sorgte er
dafür, dass sie ab und an etwas mehr Essen erhielten, in einem
abgetrennten Teil einer Baracke lebten und sich dort auch waschen
konnte.
Die täglichen quälenden Untersuchungen, die
Demütigungen, die die Familie durch Mengele erleiden musste, die
erniedrigenden Vorführungen vor dessen Ärztekollegen und die
körperlichen und seelischen Leiden, die daraus resultierten, nehmen den
Großteil des Buches ein. Koren und Negev berichten dabei auch über
Mengeles biographischen Hintergrund und seine übrige "Forschung" an
Häftlingen in Auschwitz.
Nach dem Krieg, den alle Familienmitglieder
überlebten, gingen die Ovitzens zunächst nach Antwerpen, schließlich
nach Israel, wo sie zuerst erfolgreich wieder auf der Bühne standen.
Nach Kurzem suchten sie jedoch nach einer anderen Erwerbquelle und
betrieben viele Jahre lang ein großes Kino in Haifa. Die Autoren
sprachen mit der Jüngsten der Geschwister, Perla Ovitz, die 2001 in
Haifa im Alter von 80 Jahren verstarb.
Die Recherchen der Autoren mögen durchaus gründlich
gewesen sein. Sie weisen immer wieder auf Diskrepanzen zwischen den
Erinnerungen von Perla Ovitz und anderen Überlebenden hin. Es hat
dadurch durchaus den Anschein, dass Koren und Negev die Erzählungen,
denen sie lauschten, kritisch beleuchtet haben. Schade nur, dass das
Buch trotzdem viele Mängel aufweist und es dem Leser wirklich schwer
gemacht wird, freundliche Mine zu bewahren.
Die Geschichte der Familie Ovitz ist komplex. Es ist
nicht nur die Geschichte von Judenverfolgung, von Auschwitz, vom
Überleben, es ist auch die Geschichte des gesamten Bereiches der
medizinischen Verbrechen im Nationalsozialismus. Die Ovitzens waren
Juden und zudem, in den Augen der Nationalsozialisten, Menschen mit
"Behinderung". Diese Komplexität konnten die Autoren bei Weitem nicht
befriedigen, schlimmer noch, das Buch liest sich in weiten Strecken wie
ein Panoptikum von Kuriositäten.
Alleine die Sprache, die Wortwahl, ist äußerst
problematisch. Anstatt von Kleinwüchsigkeit zu sprechen, schreiben die
Autoren ohne Unterlass von "Liliputanern" und "Zwergen". Es scheint
nicht nur den Autoren, sondern auch dem Lektorat vollkommen entgangen zu
sein, dass kleinwüchsige Menschen seit Jahrzehnten darum kämpfen, nicht
als "Liliputaner" und "Zwerge" bezeichnet zu werden. Mit politisch
korrekter Begrifflichkeit halten die Autoren es offensichtlich allgemein
nicht so genau, liest man doch auch ständig von "Zigeunern", anstatt von
"Sinti und Roma". Aber mehr noch, in Koren und Negevs Buch gehen und
laufen die "Zwerge" nicht, sie "watscheln", sie ziehen sich "puppenhaft"
an und erscheinen auch sonst gänzlich unnormal, kurios und belustigend.
Wer davon noch nicht genug hat, wird spätestens von den detailgeilen
Schilderungen der Untersuchungsprozeduren oder dem Alltagsleben der
Familie abgestoßen. Anstatt den Besonderheiten einer Familie mit
kleinwüchsigen Mitgliedern gerecht zu werden und Verständnis dafür zu
erwecken, rutschen Koren und Negev immer wieder in einen kaum zu
verbergenden Voyeurismus ab.
Wie ein Märchen erzählen die Autoren von der Familie.
Im Vorwort ist zu lesen: "Dies ist die wahre Geschichte von den sieben
Zwergen, in der es kein mildtätiges Schneewittchen gibt, sondern ein
Monster." Nichts ist gegen eine romanhafte Schilderung einer
Überlebensgeschichte einzuwenden. Fatal ist jedoch die plumpe
Vermischung von Roman und geschichtlicher Darstellung, die eine
Verniedlichung bewirkt. Fatal auch, wenn sich der Roman wie ein
Groschenheft liest.
Das Buch wird seinem Anspruch, einen Beitrag zur
Aufhellung der immer noch dunklen Geschichte von medizinischen Versuchen
in Konzentrationslagern zu leisten, nicht gerecht. Schlimmer noch, Koren
und Negev wiederholen alte Stereotypen, geben unreflektierte
Begrifflichkeiten wieder und richten damit mehr Schaden als Nutzen an. |