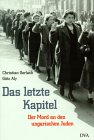
Goetz Aly/Christian Gerlach: Das letzte Kapitel. Der Mord an
den ungarischen Juden.
DVA, Stuttgart 2002
35,00 Euro[Bestellen?] |
In der internationalen
Erforschung der Shoah wurde ein europäisches Land bislang
häufig ausgeklammert: Ungarn. Neben der schwierigen
Quellenlage war dafür ausschlaggebend, dass die
Entscheidungsprozesse für die Vernichtung der europäischen
Juden spätestens mit der Wannseekonferenz im Jahre 1942
abgeschlossen waren. Die Vernichtung der ungarischen Juden
begann dagegen erst im Jahre 1944. Umso erfreulicher ist es,
dass Goetz Aly und Christian Gerlach mit ihrer Studie "Das
letzte Kapitel" umfangreich das Schicksal der ungarischen
Juden darlegen und mit neuem Quellenmaterial versuchen, die
multikausalen Gründe für eines der letzten Kapitel der Shoah
zu erklären.
Ungarn nahm zwischen 1933-1945 eine
besondere Haltung gegenüber dem faschistischen Deutschland
ein. Bereits sehr früh band es sich unter dem Reichsverweser
Horthy an den mächtigen Nachbarn. Die Annäherung vollzog
sich mit rasanter Geschwindigkeit und erreichte mit der
offenen Unterstützung des deutschen Angriffs auf die
Sowjetunion 1941 einen vorläufigen Höhepunkt. Als Ungarn
sich jedoch Anfang 1944 anschickte auszuscheren, besetzte
die deutsche Wehrmacht am 19. März das Land.
Mit der Wehrmacht kam der Stab von Adolf
Eichmann nach Budapest, der kurz vor dem absehbaren Ende des
Zweiten Weltkrieges zusammen mit ungarischen Stellen
planvoll und effizient die bis dahin physisch weitgehend
unbehelligt lebenden ungarischen Juden deportierte und
ermordete. Mehr als 400000 ungarische Juden wurden im
Zeitraum von März bis Juli 1944 in Ghettos
zusammengepfercht, deportiert und zum grössten Teil in
Auschwitz ermordet. Warum fielen kurz vor dem Ende des
faschistischen Deutschland so viele Juden der Shoah zum
Opfer? Handelte es sich um eine Vernichtung um der
Vernichtung willen, die dem eliminatorischen Antisemitismus
der deutschen Besatzer entsprach?
Aly und Gerlach verneinen das und zeigen
die multikausalen Ursachen auf, die zur Ermordung der
ungarischen Juden führten. Die unglaubliche Geschwindigkeit
der Ghettoisierung, Deportation und Ermordung resultierte
nach ihrer Ansicht einer verheerenden Verknüpfung von
deutschem und ungarischem Antisemitismus, aber auch aus der
"Umverteilung von kriegswichtigen Ressourcen", d. h. es ging
um die Versorgung der kriegsmüden ungarischen Bevölkerung
mit Gebrauchsgütern und die Stabilisierung der ungarischen
Währung, dem Pengoe. Diese Verknüpfungen wurden bislang
nicht erforscht.
Aly und Gerlach haben umfassendes
Dokumentenmaterial gesichtet und so zum ersten Mal auch die
Finanzierung der Kriegs- und Besatzungskosten analysiert.
Sie zeichnen ein sehr komplexes Bild der Judenverfolgung in
Ungarn, wobei die Materialmenge manchmal zu
Unübersichtlichkeit führt. Die Maßnahmen gegen die jüdische
Bevölkerung Ungarns radikalisierten sich im Verlauf kurzer
Zeit. Diese Periode war weitaus kürzer als in
vorangegangenen Phasen der Shoah, verlief in Ungarn in
atemberaubendem Tempo. Die Autoren beschreiben diese
Radikalisierung akribisch und werten dabei des Öfteren
bislang unbeachtete Dokumente aus.
Überhaupt besticht die Studie von Aly und
Gerlach durch ihre gute Quellenbasis und das Bemühen, sie zu
sortieren. Leider bleibt es noch allzuoft beim Bemühen. Die
Autoren sind sich dessen auch bewusst. Neben den ungarischen
analysieren sie immer auch die deutschen Interessen an der
Vernichtung und zeigen auf, dass die Vernichtung nicht im
Widerspruch zur deutschen Kriegsführung stand. Zwar wurde
eine große Anzahl kriegswichtiger Züge zur Deportation
verwendet, das enteignete jüdische Vermögen und die
Habseligkeiten der Deportierten wogen das jedoch mehr als
auf. Die Umverteilung des jüdischen Eigentums diente somit
unmittelbar einer kurzfristigen Verbesserung der Kriegslage.
Ein siegreicher Krieg schien der ungarischen Regierung ein
Garant für die Sicherheit der neuen, durch den Krieg und den
Einfluss Deutschlands entstandenen Grenzen zu sein.
Schließlich hatte Ungarn sein Territorium zwischen 1938-1941
beinahe verdoppelt.
Der Studie fehlen die Stringenz und der
rote Faden. Aly und Gerlach bleiben oft nicht bei einem
Themenaspekt, sondern springen von Kapitel zu Kapitel, so
dass eine Orientierung schwerfällt. Beim Leser bleibt nach
der Lektüre eine leichte Verwirrung zurück – die Ordnung des
Textes muss man schon selbst gedanklich herstellen. |