Zu viel Geschichte, zu wenig Geographie:
Das Los des jüdischen Volkes
Das Vorwort zur inzwischen als Taschenbuch
vorliegenden "
Eli Barnavi
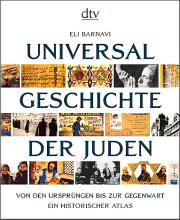 Zu
viel Geschichte, zu wenig Geographie - dieser berühmte Aphorismus, mit dem
Sir Isaiah Berlin versuchte, das Los des jüdischen Volkes kurz und bündig
auf einen Nenner zu bringen - kam mir bei der Lektüre der Korrekturfahnen
zur
dieses Buches in den Sinn. Zu
viel Geschichte, zu wenig Geographie - dieser berühmte Aphorismus, mit dem
Sir Isaiah Berlin versuchte, das Los des jüdischen Volkes kurz und bündig
auf einen Nenner zu bringen - kam mir bei der Lektüre der Korrekturfahnen
zur
dieses Buches in den Sinn.
Nicht genug Geographie? Warum? Selbst ein flüchtiger Blick
auf diesen Atlas enthüllt, daß die Karten des Verlaufs der jüdischen
Geschichte faktisch die ganze Welt abdecken. Das Interesse an einer
Kurzfassung der jüdischen Geschichte sollte keinesfalls einzig und allein
auf eine jüdische Leserschaft beschränkt sein. Ganz im Gegenteil, gerade da
die Juden für über 2.000 Jahre nicht in eigenen Ländern lebten, war ihr
Schicksal stets auf untrennbare Weise mit der Geschichte anderer Nationen
und Kulturen verflochten.
Die Fachhistoriker, die an diesem Atlas mitgewirkt haben,
waren bemüht, ein hohes wissenschaftliches Niveau zu wahren, ohne einem
wissenschaftlichen "Jargon" zu verfallen, der den Nichthistoriker
abschrecken würde. Das Buch kann als eine, von Kapitel zu Kapitel
aufeinander aufbauende und zusammenhängende Erzählung gelesen werden.
Gleichermaßen bildet aber auch jedes Kapitel eine Einheit für sich. Jedes
Kapitel umfaßt eine Doppelseite mit vier Abteilungen: einem Text, der dem
Leser wesentliche Einsichten in eine bestimmte Periode, ein soziokulturelles
Thema oder einen grundlegenden Mythos vermitteln soll; eine Landkarte oder
eine Verbindung verschiedener Karten, durch die die dargestellten
historischen Ereignisse in die Dimension des Raumes übertragen werden; eine
Chronologie der behandelten Ereignisse; und schließlich Illustrationen, die
den Text nicht einfach ausschmücken, sondern dem Leser helfen sollen,
zentrale Aspekte des Themas plastisch und in ihrer historischen Vielfalt zu
erfassen.
Der chronologische "Ausflug" in die Geschichte des
jüdischen Volkes wird regelmäßig von Kapiteln unterbrochen, in denen
einzelnen Themen durch die Geschichte nachgegangen wird: die
Wanderbewegungen, die Kunst des Manuskripts, die Idee des Monotheismus,
religiöse Tabus, die Beziehung von Staat und Religion, die Legende des
Ewigen Juden usw. Drei Texte sollen den Leser zu Beginn in übergreifende
Fragestellungen einführen: Die ersten beiden analysieren jüdische
Vorstellungen von Raum und Zeit, während der dritte Text wichtige
demographische Veränderungen einer Nation skizziert, der versprochen wurde,
so zahlreich zu werden „wie die Sterne des Himmels und der Sand am Rande des
Meeres" (1. Buch Moses, 22:17).
Einem Buch liegt stets eine Reihe von Entscheidungen zu
Grunde - manche eher schmerzhaft. Eine unserer Entscheidungen war, daß es
sich um eine Geschichte des jüdischen Volkes und nicht des Judaismus oder
des jüdischen Glaubens handeln sollte. Das war nicht als ideologisches
Postulat gedacht, sondern ergab sich aus historischen Überlegungen. Wie
könnte man auch eine Chronik des Volkes Israel anlegen, ohne dessen Existenz
vorauszusetzen? Einzig in diesem Sinn kann der Ausspruch von Sir Isaiah
richtig verstanden werden: Seine Bedeutung des Wortes "Geographie", die den
Juden so bitterlich abging, läuft auf das Fehlen einer "nationalen
Geographie" hinaus. Kurz, zu viel Geschichte, zu wenig Staat.
Zu viel Geschichte, zu wenig Staat
Nachdem dies einmal geklärt war, begannen jedoch die
wirklichen Probleme. Welchen Platz sollte der Staat Israel einnehmen in
einem Freskogemälde wie dem vorliegenden, das sich bemüht, die
Universalgeschichte der Juden von Ur bis New York, von Babylon bis Tel Aviv
nachzuzeichnen. Anders gesagt, kann man die Transformation einer
„nationalen" Perspektive in einer teleologischen Erzählung vermeiden, in der
die viertausendjährige Geschichte des jüdischen Volkes, als unvermeidlich zu
einem spezifischen Ende führend, verstanden wird? Würde man damit nicht
rückwirkend der ganzen Geschichte eine vorbestimmte Bedeutung geben? Wie
läßt sich eine judeozentrische Geschichtsbetrachtung vermeiden, wie kann man
ihr widerstehen?
Schließlich, wie kann die jüdische Geschichte aus dem Tal
der Tränen, mit dem sie so oft assoziiert wird, befreit werden - ein
Unterfangen, um das sich Salo Baron bereits vor einem halben Jahrhundert in
seinem monumentalen Werk "Eine soziale und religiöse Geschichte der Juden"
bemühte. Die zionistische Mythologie - und alle nationalen Bewegungen nähren
sich von ihren eigenen Mythen - tendiert dazu, die zwanzig Jahrhunderte des
Exils als einen langen beschwerlichen Treck durch einen dunklen und
schmutzigen Tunnel darzustellen, um dieses unüblich lange "Mittelalter" dann
in eine nationale "Renaissance" münden zu lassen. Doch heute wird die
Diaspora nicht mehr auf diese Art und Weise betrachtet, und wir haben uns
bemüht, ihr wieder den angebrachten Platz zukommen zu lassen. Abgesehen
davon schien es uns wesentlich, der intellektuell sterilen Wahrnehmung der
jüdischen Geschichte als einer kontinuierlichen Abfolge von Leiden, Pogromen
und nationaler Erlösung unter dem Motto "alle gegen uns" zu widerstehen.
"Siehe da ein Volk, abgesondert wohnt es und unter die
Völker läßt es sich nicht rechnen" (4. Buch Moses, 23:9). Diese Prophezeiung
von Bileam bildet zweifelsohne das Hauptproblem der Geschichte, aber es ist
nicht die ganze Geschichte.
Hier liegt nun unsere Universalgeschichte der Juden vor.
Ich möchte meinen Dank all denen aussprechen, die dies ermöglicht haben: Dem
Team von Hachette-Litterature in Paris bin ich zu Dank verpflichtet, vor
allem Francoise Cibiel-Lavalle, die sich nicht nur als eine hervorragende
Lektorin, sondern als eine aufmerksame und verständnisvolle Freundin
erwiesen hat. Danken möchte ich auch Pierre Vidal-Naquet, dessen umfassende
Belesenheit uns manche Fallgrube erspart hat. In Israel, wo dieses Projekt
entwickelt und durchgeführt wurde, möchte ich dem Team von Tel Aviv Books
danken, allen voran Mulli Melzer, dem Lektor, und Dani Tracz, dem Direktor.
Ohne diese zwei Gefährten, wäre dieses Abenteuer nicht nur ein geringeres
Vergnügen, sondern einfach unmöglich gewesen.
Abschließend eine persönliche Anmerkung: Wie in jedem
Gemeinschaftsunternehmen sind die Ideen und Meinungen in den verschiedenen
Kapiteln den jeweiligen Autoren zuzuschreiben, doch die abschließende
Verantwortung liegt bei mir. Lord Acton drückte einst seinen Wunsch aus, die
Schlacht von Waterloo so zu präsentieren, daß Engländer und Franzosen,
Deutsche und Holländer gleichermaßen zufrieden gestellt wären. Das war in
der Tat eine edle Idee. Doch im Unterschied zu Waterloo gehen Israels Kämpfe
bis auf den heutigen Tag weiter, rufen Leidenschaften und erbitterte
Diskussionen hervor. Genausowenig wie hier Platz für Provokationen war, ist
ein Konsens angestrebt worden. Es ist daher nur logisch, wenn viele Leser
mit einzelnen Kapiteln nicht übereinstimmen - und dies sogar aus diametral
entgegengesetzten Gründen. Das ist vielleicht auch unvermeidbar. Unstrittig
sind in der Geschichtswissenschaft nur die bewiesenen Fakten, ihre Bedeutung
ist eine Frage der Interpretation.
Über die deutsche Ausgabe
Frank Stern
Dieser Atlas entstand in Israel. Entworfen von
französischen und israelischen Wissenschaftlern liegt das Buch inzwischen in
vier Sprachen vor. Die deutsche Ausgabe, obgleich sie sich weitgehend an der
englischen Fassung orientiert, fußt ebenso auf der hebräischen und
französischen Ausgabe. Doch handelt es sich nicht einfach um eine
Übersetzung. Die Welt der deutschen Sprache, Assoziationen und
Konnotationen, die für den deutschen Kulturkreis von Bedeutung sind, sowie
Ereignisse der deutschen und österreichischen Geschichte waren zu
berücksichtigen, über Kürzungen war zu entscheiden, Erweiterungen in
Erwägung zu ziehen. Zugleich galt es, Geist, Stil und Absicht der
individuellen Autoren so weit wie möglich zu bewahren.
Der Charakter einer Darstellung der Geschichte des
jüdischen Volkes ließ es geboten erscheinen, spezifisch jüdische
Konzeptionen und hebräische Termini zu benutzen und sie im Verlauf der
Darstellung zu erklären. Nicht alles, was aufgrund der deutschen Geschichte
heute im Hinblick auf die jüdische Geschichte Sprachgebrauch zu sein
scheint, wurde vorschnell übernommen. Der Assoziation sollte auch auf dem
Feld der Sprache und Begriffe die Analyse vorangehen.
Mein besonderer Dank gilt Adina Stern, die sich auf der
Suche nach verbindlichen Schreibweisen und deutschsprachigen Übersetzungen
der Quellen durch wahre Berge von Literatur, Atlanten und Wörterbüchern
wühlen mußte. Ohne ihre Hilfe hätte sich so mancher wissenschaftliche Engpaß
als Sackgasse erwiesen. Ihr wie auch Susanne Stern sei darüber hinaus für
das wiederholte Lesen der Korrekturfahnen und die Sorge um die
Einheitlichkeit des Buches gedankt. Hierbei konnten wir viel von der
Zusammenarbeit mit Mulli Melzer und Dani Tracz von Tel Aviv Books und deren
Erfahrungen mit der hebräischen, französischen und englischen Ausgabe
profitieren. Von Bedeutung bei der Schlußredaktion der deutschen Ausgabe war
auch die konstruktive Zusammenarbeit mit Anna Lorenz in Wien, die auf der
Seite des Christian Brandstätter Verlages lektorierend und mit wohlbedachten
Vorschlägen unsere Arbeit unterstützte. Abschließend sei angemerkt, daß die
Häufung der Familiennamen Stern des Tel Aviver Teams keine
verwandtschaftlichen Hintergründe hat, sondern rein zufällig ist. Allen drei
gemeinsam ist allerdings, daß sie zwischen den 60er und 80er Jahren aus der
Bundesrepublik Deutschland und aus Österreich nach Israel gegangen sind,
sozusagen aus persönlicher Perspektive zu den Wanderbewegungen der Juden
beigetragen haben.
[BESTELLEN?]
hagalil.com
28-03-04 |