|
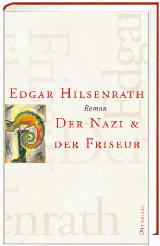
Edgar Hilsenrath:
Der Nazi & Der Friseur
Gesammelte Werke Band 2, hrsg. v. Helmut Braun
Dittrich Verlag 2004
Euro 22,90
Bestellen?
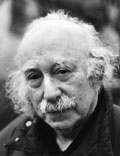
Edgar Hilsenrath
Geboren 1926 in Leipzig. 1938 flüchtete er mit der Mutter und dem jüngeren
Bruder nach Rumänien. 1941 kam die Familie in ein jüdisches Ghetto in
der Ukraine. Hilsenrath überlebte und wanderte 1945 nach Palästina, 1951
in die USA aus. Heute lebt er in Berlin.
1989 erhielt Edgar Hilsenrath den Alfred-Döblin-Preis, 1992 den
Heinz-Galinski-Preis, 1994 den Hans-Erich-Nossack-Preis, 1996 den
Jacob-Wassermann-Preis und 1999 den Hans-Sahl-Preis.
2004 wurde Edgar Hilsenrath mit dem Lion-Feuchtwanger-Preis für sein
literarisches Gesamtwerk ausgezeichnet. |
Der Nazi & Der Friseur:
Wer hat Itzig Finkelstein erschossen?
Von Andrea Livnat
Edgar Hilsenrath wurde im November vergangenen Jahres
mit dem Lion-Feuchtwanger-Preis der Akademie der Künste Berlin für sein
literarisches Gesamtwerk ausgezeichnet. Der Dittrich Verlag begann mit
der Publizierung von Hilsenraths Gesammelten Werken in elf Bänden. Der
Autor erhält damit endlich die Würdigung, die seinem Werk zusteht und
die ihm in Deutschland lange Zeit nicht gewährt wurde.
Die Geschichte der Publikation des vorliegenden Romans
Der Nazi & Der Friseur ist dafür das beste Beispiel. 1975 verließ
Hilsenrath die USA, wo er seit 1951, nach einer Zwischenstation in
Palästina, lebte und kehrte nach Deutschland zurück. Im
englischsprachigen Raum waren seine bisher erschienenen Romane zu dieser
Zeit bereits ein großer Erfolg. 1966 war Hilsenraths erster Roman
Nacht von einem New Yorker Verlagshaus veröffentlicht worden. Der
Verlag war an einem zweiten Roman interessiert und Hilsenrath hatte die
Idee bereits im Kopf. Mit dem Vorschuss reiste er nach München, um seine
Idee in "authentischer" Umgebung umzusetzen. So entstand Der Nazi &
Der Friseur, das Originalmanuskript ist in deutsch verfasst. Das
Buch erschien schließlich 1971 unter dem Titel The Nazi & The Barber.
In den folgenden vier Jahren erschien der Roman auch in England, Italien
und Frankreich.
Nur in Deutschland fand sich für Hilsenraths Buch kein
Verleger, auch nicht nachdem Hilsenrath nach Berlin umgezogen war und
Hilfe bei der Verlagssuche erhielt. Mehr als 60 Verlage haben abgesagt,
schreibt Helmut Braun in seinem Nachwort der Neuausgabe. Helmut Braun
war es auch, der den Roman in seinem kleinen Literarischen Verlag 1977
herausbrachte.
In einem Interview erzählt Hilsenrath, dass er zuerst
Zweifel hatte: "Der Braun-Verlag war sehr klein, deshalb dachte ich: Das
kann nichts werden. Aber Braun hat das Buch doch durchgesetzt. Er ist
selbst zum Spiegel gefahren, und hat es ihnen auf den Tisch geknallt und
gesagt: Lest das mal. Sie haben's gelesen, und auch rezensiert. Der
Spiegel war damals, 1977, einflußreicher als heute; danach hat die ganze
Presse mitgezogen: der Stern, Die Welt, schließlich Heinrich Bölls
Besprechung in der Zeit. Nachher wurde der Roman auch in Deutschland ein
großer Erfolg."
Hilsenrath war mit seinen ersten Romanen seiner Zeit
weit voraus. In Nacht stellt er das Ghetto unter völligem
Ausschluss der Täterperspektive dar. Die Juden im fiktiven Ghetto
Prokow, das als Symbol für alle Ghettos steht, werden in einer Art und
Weise dargestellt, die Kritiker dazu veranlassten, den Roman als
antisemitisch zu bezeichnen. Dabei hat Hilsenrath die Situation im
Ghetto lediglich in ihrer ganzen selbstvernichtenden Realität gezeigt,
er lässt seinen Protagonisten zum Frauenschänder und Leichenfledderer
werden, lässt ihn so tief sinken, wie er in der Vernichtungsmaschinerie
sinken musste.
Auch Der Nazi & Der Friseur schert sich nicht
weiter um die gängigen Erzählstrukturen der Schoah. Der Roman ist das
genaue Gegenteil zu Nacht, erzählt er doch in konsequenter Weise
ausschließlich aus der Sicht des Täters. Hilsenrath wurde "literarischer
Dilettantismus" vorgeworfen, seine Phantasien seien "roh und grausig".
Fritz J. Raddatz sprach von "Wortgeklingel statt angemessenem Schweigen"
und sah sich bemüßigt, dem Überlebenden Hilsenrath damit vorzuschreiben,
wie jener sich an die Schoah zu erinnern habe.
Hilsenrath selbst sagte einmal in einem Interview, dass
sich in seinen Geschichten nichts anderes widerspiegele als die
Geschichte eines überlebenden "Juden deutscher Kultur".
Ganz offensichtlich ist es aber genau das, was die
Kritik, die Verleger, das Publikum störte. Denn Hilsenrath schreibt so
ganz anders als man sich das von einem Schoah-Überlebenden vorstellt. Er
ist provozierend, schockierend, sarkastisch, und damit vor allem eines,
unbequem. Das passte nicht in die philosemitische Stimmung des
Nachkriegsdeutschlands, das seine Juden gut behandelt, vorausgesetzt,
sie benehmen sich entsprechend. In einer Fernsehdiskussion sagte
Hilsenrath 1978, dass die geheuchelte Zuneigung zum Judentum, die in der
BRD gepflegt wird, nur eine andere Art von Antisemitismus sei.
Freilich bietet der Protagonist wenig Angenehmes. "Ich
bin Max Schulz, unehelicher, wenn auch rein arischer Sohn der Minna
Schulz..." beginnt der Roman. Max Schulz wächst in einem sozialen Wust
auf, sein Stiefvater Slavitzki ist ein versoffener Friseur, der den
Leuten Treppen schneidet und ins Waschbecken pinkelt. Zuhause gibt es
vor allem eines: Misshandlungen und Prügel.
Max Schulz freundet sich mit dem jüdischen Jungen von
gegenüber an, Itzig Finkelstein. Dessen Vater hat auch einen
Friseurladen, oder besser einen "Salon", der sich "Der Herr von Welt"
nennt. Max und Itzig werden unzertrennbar: "Ich, Max Schulz, rein
arischer Sohn der Minna Schulz, lernte bei den Finkelsteins Jiddisch,
machte mich mit Hilfe meines Freundes Itzig mit den hebräischen
Schriftzeichen vertraut, begleitete meinen Freund am Samstag in die
kleine Synagoge in der Schillerstraße". Schon hier ist die eigentliche
Natur von Max Schulz klar, er ist ein Mitläufer. Gemeinsam mit Itzig
drückt er die Schulbank, besteht darauf, ins Gymnasium zu gehen, genau
wie Itzig, und fängt schließlich, genau wie Itzig, eine Friseurlehre bei
dessen Vater Chaim an. Während Itzig blond und blauäugig ist, hat Max
Schulz, der spätere Massenmörder, "schwarze Haare, Froschaugen, eine
Hakennase, wulstige Lippen und schlechte Zähne" und sieht damit aus "wie
ein Jude".
Seit Anfang der 30er Jahre wird in Max Schulz' Familie
viel von Adolf Hitler gesprochen, Max wird Mitglied der NSDAP und
schreibt sich mit seinem Stiefvater bei der SA ein. Von einem Tag auf
den anderen ist die Freundschaft mit Itzig Finkelstein vergessen. Max
Schulz geht zur SS, in der Kristallnacht brennt Finkelsteins
Friseurladen ab. Dann kommt der Krieg, Max Schulz ist in Polen und
Rußland, ist an Massenerschießungen beteiligt: "Wissen Sie, wie man
30.000 Juden in einem Wäldchen erschießt? Und wissen Sie, was das für
einen Nichtraucher bedeutet? Dort hab ich das Rauchen gelernt." Und
kommt schließlich in das Konzentrationslager "Laudwalde", wo er seinen
"Dienst" tut, bis der Krieg zu Ende ist.
Im zerstörten Deutschland zurück, nach einer Odyssee
durch Polen, bei der er auf eine alte Frau trifft, die ihn zu Tode
quälen will, fasst Max Schulz schließlich einen Beschluss: "'Wenn es ein
zweites Leben für dich gibt, dann solltest du es als Jude leben.' Und
schließlich ... wir haben den Krieg verloren. Und die Juden haben ihn
gewonnen. Und ich, Max Schulz, war immer ein Idealist. Aber ein
besonderer Idealist. Einer, der sich das Mäntelchen nach dem Wind hängt.
Weil er weiß, daß es sich leichter an der Seite der Sieger lebt, als an
der Seite der Verlierer."
Max Schulz nimmt die Identität seines einstigen Freundes
Itzig Finkelstein an, der den Krieg nicht überlebt hat. Mit einem Sack
voll Goldzähne aus dem KZ als Starthilfe ausgestattet, macht der nun
beschnittene und mit einer Auschwitz-Nummer auf dem Arm ausgestattete
Massenmörder Max Schulz auf dem Schwarzmarkt gute Geschäfte. Zuvor
steckt man ihn in ein DP Lager. Die Prüfungskommission muss er nicht
groß überzeugen, sie will weder seine KZ-Nummer noch sein beschnittenes
Glied sehen, das Aussehen des Massenmörders reicht der Kommission, für
sie steht eindeutig fest, dass er nur ein Jude sein kann.
Durch die Schwarzmarktgeschäfte lernt Itzig Finkelstein
alias Max Schulz eine Gräfin kennen, bei der er einzieht, die ihm bei
den Geschäften hilft, mit der ihn ansonsten jedoch wenig verbindet.
Entsetzt stellt er fest: "Es ist klar: Die Gräfin ist eine Antisemitin!"
Die Groteske nimmt nun endgültig ihren Lauf, fühlt sich der Massenmörder
Max Schulz doch in seiner jüdischen Identität gekränkt. Er beginnt zu
lesen, jüdische Geschichte, die Makkabäer, Trumpeldor, Theodor Herzl.
"Ich weiß nicht, warum ich die Gräfin beeindrucken will. Habe ich einen
Minderwertigkeitskomplex? Und ist dieser Komplex ein typisch jüdischer?"
Nachdem alles Geld verloren ist, zieht Max Schulz/Itzig
Finkelstein aus, lernt in seiner neuen Hotelunterkunft einen anderen
Überlebenden kennen und entschließt sich dazu, nach Palästina
auszuwandern.
Es beginnt die waghalsige Überfahrt, die Landung vorbei
an englischen Truppen. In Palästina angekommen sucht sich Itzig
Finkelstein alias Max Schulz ein kleines Städtchen als neuen Wohnort
aus, findet in einem Friseursalon Anstellung, wird ein geachtetes
Mitglied der Gemeinde, kämpft im Untergrund gegen die englische
Besatzung und schließlich auch im Unabhängigkeitskrieg, heiratet und
führt ein durch und durch bürgerliches Leben. Doch so sehr sich Max
Schulz oder jetzt Itzig Finkelstein auch anstrengt, er kann nicht Opfer
sein, seine Strafe besteht letztlich darin, dass er mit seinen
Gewissensbissen stirbt. Und bis zum Ende bleibt auch die Frage offen:
"Wer hat Itzig Finkelstein erschossen?"
Heinrich Böll bezeichnete den Protagonisten Max Schulz
in einer Rezension aus dem Jahre 1977 als "blutbesudelten Hans im
Glück". Max Schulz ist ein grotesk-satirisch überzeichneter Mitläufer,
kein Antisemit, er hasst die Juden nicht. Er hat nur "mitgemacht! Bloß
mitgemacht! Andere haben auch mitgemacht. Das war damals legal!"
Hilsenrath griff eine Frage auf, die die Deutschen noch viele Jahre
beschäftigen sollte und die bis heute in den Diskussionen, wie
beispielsweise um die Wehrmachtsausstellung, hoch kocht. Wer ist
schuldig? Max Schulz erhält im Ürbigen einen Freispruch.
Heute liegt der einstige Stein des Anstoßes bei der
Kritik als Neuauflage, Band 2 der Gesammelten Werke Hilsenraths im
Dittrich Verlag, vor und es sei jedem empfohlen, sich selbst ein Bild zu
machen. Hilsenraths satirisches Eintauchen in die Täterperspektive ist
deftig, nimmt kein Blatt vor den Mund und verlangt dem Leser einiges an
Nerven ab. Eindeutig das größte Lesevergnügen des Jahres 2004!
hagalil.com
02-01-05 |