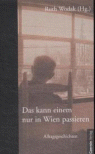
Bestellen |
Über der
Stadt liegt ein brauner Schleier. Das Umschlagbild des im Czernin-Verlag
herausgekommenen Büchleins mag auf seinen Inhalt verweisen, oder auch
nicht. Erzählt wird darin von der fehlenden Selbstverständlichkeit,
heute Jüdin oder Jude zu sein in Wien. Drei Frauen und fünfzehn Männer
melden sich zu Wort. Alle AutorInnen haben einen Wien-Bezug, sie leben
dort, sind dort geboren und/oder aufgewachsen, wurden aus Wien
vertrieben oder haben Eltern, die aus Wien vertrieben wurden.
Sie erzählen
Geschichten, die ihnen in dieser Stadt passiert sind und von den
Reaktionen ihrer Umwelt auf ihre jüdische Herkunft. Da gibt es die junge
Frau, die von einem Lehrer zu hören bekommt, daß Juden stinken, während
er sich nach ihrem Parfüm erkundigt, eine andere wird, mit einem Blick
auf ihren Chaj-Anhänger gefragt, ob sie denn tatsächlich eine
„waschechte Wienerin" sei, ein dritter kriegt anonym per e-mail zu
lesen, dass er sicher „ein Jud" sei, der die Österreicher „so frech"
belehrt und Hitler habe leider auch bei ihm ein Ausnahme gemacht. Neben
unverhohlen gezeigtem Antisemitismus – es wird von einem Kellner erzählt
der keine Juden bedienen will, von einer Tante der christlichen
Freundin, die einem Juden nicht die Hand geben will, von einem Mann, der
einer jungen Frau ins Gesicht spuckt, nachdem er sie vorher gefragt hat,
ob sie Jüdin sei – kommen auch subtilere Ablehnungen zum Ausdruck.
So etwa die
Erfahrung einer aus Wien vertriebenen Frau, die zur Anerkennung ihres
Medizinstudiums nach dem Holocaust in Wien die Nostrifikationsprüfung (
Anm. d. Red.: Anerkennungsprüfung einer nicht-österreichischen
Universitätsausbildung) ablegen mußte und, wie so viele RückkehrerInnen
und Überlebende, mit jener „Mischung aus Heimtücke und Schmeichelei"
konfrontiert wurde, der gemeinhin als Wiener Charme gilt. Manche
Geschichten erhalten während des Erzählens eine Eigendynamik,
verselbständigen sich sozusagen. Phantasie und Wirklichkeit sind, wie im
Leben, oft nicht auseinander zu halten. Es ist ein schwankender Boden
auf dem sich die Erzählenden bewegen. Manchmal tun sich Abgründe dort
auf, wo sie keine Phantasie sich ausmalen könnte. Lange hat die
Herausgeberin gezögert, in jener Abendrunde aus der schließlich die
Pläne zum Buch entstanden, von ihrem Therapeuten zu erzählen. Er war
Mitglied der Waffen-SS gewesen. Ein anderer erzählt davon, mit welchen
Strategien er als Kind nach einem antisemitischen Vorfall bei einem
Schikurs seine Eltern beruhigte.
Neben bekannteren
Autoren wie Robert Schindel, Carl Djerassi und Doron Rabinovici kommen
auch weniger prominente Personen, hauptsächlich aus dem Wissenschafts-
und Kulturbereich, zu Wort, darunter auch ein Vater-Tochterpaar. Die
Tochter, Ruth Jolanda Weinberger, trägt das Erbe ihrer Urgrossmutter,
nach der sie benannt ist und die in Auschwitz ermordet wurde. Ihre
Diplomarbeit schrieb sie über die Shoah. Bei Aufenthalten in den USA und
in Israel versucht sie herauszufinden, was jüdisch-sein jenseits einer
Geschichte der Zerstörung im Holocaust bedeuten kann. Rubina Möhring
erzählt von ihrer Vision einer Strafanstalt für Medientäter anlässlich
der Diskussionen zum Paragraphen 56. Doron Rabinovici beschreibt in
seiner Parodie auf die Wiener Kulturszene die Dankbarkeit von
PolitikerInnen und Publikum gegenüber einem vertriebenen jüdischen
Autor, dessen Werk verschollen ist und das man daher anlässlich seiner
Ehrung nicht zu lesen braucht. Stephen Laufers Erzählung gibt Einblick
in die komplexe Emigra- tionsgeschichte seiner Familie. Seine Großeltern
emigrierten in den Dreißigerjahren nach Johannesburg, der Sohn
engagierte sich als weißer Kommunist im südafrikanischen Apartheid-
staat, lebte später in der DDR und starb schließlich in Italien, sein
Sohn, Stephen Laufer wiederum emigrierte aus Südafrika nach Europa, um
nicht in die Armee des Apartheidstaates dienen zu müssen.
Schindel erzählt
gekonnt vom Zerrissensein zwischen seiner Liebe zu Wien und dem Wissen,
immer auf der Hut sein zu müssen. Schindel, 1944 in Oberösterreich
geboren, überlebte - im Gegensatz zu seinen Eltern – als jüdisches Baby
jene Zeit von der Irena Klepfisz, 1941 in Warschau geboren, schreibt:
during the war
germans were known
to pick up infants
/by their feet
swing them through the air
and smash their heads
against plaster walls.
Somehow
I managed
to escape that fate.
(A few Words in the Mother Tongue. Oregon 1990).
haGalil onLine
05-02-2002 |