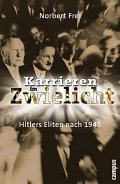
Norbert Frei,
Karrieren im
Zwielicht. Hitlers
Eliten nach 1945,
Campus Verlag
2001
Euro 25,50
Bestellen? |
"Karrieren im Zwielicht" ist das Begleitbuch zu
einer sechsteiligen Fernsehdokumentation des Südwestrundfunks, die im
Sommer 2002 in Deutschland ausgestrahlt wurde. Die Sendung und das Buch
berichten von Männern, die zu "Hitlers Eliten" zählten und auch noch
nach der "Stunde Null" ihre Chance zu wahren wussten. Ihre zum Teil
glänzenden bundesdeutschen Karrieren, die sie trotz bzw. wegen ihrer
nationalsozialistischen Vergangenheit einschlagen konnten, stehen im
Mittelpunkt der Betrachtung.
Unter der Federführung von Norbert Frei haben sich vier –
durchweg junge Historiker – den beruflichen Werdegängen von Medizinern
(Tobias Freimüller), Unternehmern (Tim Schanetzky), Offizieren (Jens
Scholten), Juristen (Marc von Miquel) und schließlich Journalisten
(Matthias Weiß) gewidmet, wobei die Beiträge durch ein Vorwort von
Thomas Fischer und eine Bilanz von Norbert Frei flankiert werden.
Am 5. Mai 1945 notierte Victor Klemperer in sein
Tagebuch, dass nun niemand mehr ein Nazi sein will von denen, die es
fraglos gewesen sind. [1] In diesem Zusammenhang bildete "Hitlers-Elite"
keine Ausnahme, und die Zeichen der Zeit standen günstig für sie, denn
Deutschland lag in Trümmern und überall herrschte das Chaos der
Nachkriegstage. In dieser Situation bot sich für die
nationalsozialistische Nomenklatura die durchaus denkbare Möglichkeit,
dass sich die Alliierten als Pragmatiker erweisen und auf das vorhandene
Expertenwissen der einschlägigen Berufgruppen zurückgreifen würden (S.
305/306). Indes sollte sich diese Hoffnung als trügerisch entpuppen. Die
Besatzungsmächte waren gut informiert. Zielsicher gelang es ihnen, die
exponierten Funktionsträger herauszufiltern. Angesichts der Internierung
von immerhin 250.000 Deutschen sowie der zum Teil ausgesprochen rigiden
Säuberungsmaßnahmen im Beamtenapparat und nicht zuletzt aufgrund der
Nürnberger Prozesse, trat jedoch der Entschluss der Alliierten die
Entnazifizierung massiv voranzutreiben unverkennbar deutlich zu Tage.
Gleichwohl verlor das engagierte Vorgehen der westlichen Siegermächte
bereits Ende der vierziger Jahre erheblich an Schwung (S. 310). Dafür
war vor allem der sich anbahnende kalte Krieg, Deutschlands
geopolitische Lage, und dass berechtigte Anliegen der Alliierten in
Deutschland eine stabile Demokratie zu installieren verantwortlich.
Diese Entwicklung kam für viele Deutsche nicht ungelegen: Hitler,
Himmler, Göring und Goebbels waren tot, und daher lag es nahe sich als
"verführter Mitläufer" zu exkulpieren. Der Wiederaufbau und das
Wirtschaftswunder taten ein übriges, und so bot sich nicht wenigen aus
der "Elite Hitlers" eine "zweite Chance".
Wie Jens Scholten in seinem Beitrag über die Offiziere
zeigt, gehörte zu diesem Kreis zweifellos Reinhard Gehlen. Seine
Karriere war im wahrsten Sinne des Wortes doppelt zwielichtig.
Generalmajor Gehlen war Geheimdienstler, und in dieser Funktion leitete
er ab 1942 beim Generalstab des Heeres die Abteilung "Fremde Heere Ost"
(S. 135). Angesichts der drohenden Niederlage der deutschen Wehrmacht
handelte Gehlen zunächst taktisch äußerst versiert, indem er sowohl
seine Mitarbeiter als auch die geheimen Archivunterlagen seiner
Abteilung rechtzeitig vor der "Roten Armee" in Sicherheit brachte. Nach
der Kapitulation offenbarte er sich zügig den Amerikanern, die für den
Geheimdienstler schnell eine "bruchlose Weiterverwendung" fanden (S.
135). In der Tat erwies sich die Beziehung Gehlens zu der amerikanischen
Besatzungsmacht als geradezu abstrus. Gehlen - der sich seiner Position
als Geheimnisträger voll bewusst war - stellte kaum einen Monat nach
seiner Gefangennahme Bedingungen, in denen er sich zu einer
Zusammenarbeit mit den Amerikanern bereit erklärte. Für einen Mann, der
praktisch ein Kriegsgefangener war und den die Russen eventuell sogar
für einen Kriegsverbrecher halten mochten, war das eine ungeniert
dreiste Vorgehensweise. [2] Gleichwohl gingen die Amerikaner darauf ein,
und so begann Gehlen bereits 1946 mit dem Aufbau eines
Auslandsnachrichtendienstes, besser bekannt unter dem Namen
"Organisation Gehlen". Dabei ließen die Amerikaner Gehlen offenbar
weitestgehend freie Hand. In seinen Memoiren bemerkte Gehlen hierzu,
dass US-General Sibert klar übersah "dass die Interessen zwischen den
Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik auf lange Zeit identisch sein
würden." [3] Was mit anderen Worten heißt: Was den deutschen Interessen
nützte, war auch den Amerikanern dienlich. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass Gehlen alsbald auf "alte Kontakte" zurückgriff.
Diese bestanden unter anderem zur SS, zum SD und zur Gestapo. So wurde
beispielsweise der ehemalige SD-Mitarbeiter Dr. Rudolf Oebsger-Röder -
der nachweislich zu etlichen "Einsätzen" in Polen, der Sowjetunion und
in Ungarn abkommandiert war - nunmehr aufgrund seiner "Erfahrung"
angeworben. [4] Am 1. April 1956 avancierte die "Organisation Gehlen"
zum Bundesnachrichtendienst, kurz BND. Dieser unterstand unmittelbar dem
Bundeskanzleramt. Dort fungierte Dr. Hans Globke als Adenauers
Kanzleramtschef. Dieser hatte maßgeblich die Nürnberger Gesetze von 1935
kommentiert (S. 331 f). Als Gehlen schlussendlich 1968 aus dem Amt
schied, erhielt er das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und
Schulterband. Seine überaus publikumswirksam inszenierte Biographie "Der
Dienst" [5] legitimierte nicht nur das deutsche Vorgehen im
Russlandfeldzug, sondern sie stellte zudem die Kompetenz der Wehrmacht
im Umgang mit dem Gegner heraus.
Gehlen kolportierte in seinem Werk ein
"Wehrmachtsbild", das bis in die neunziger Jahre hinein Bestand haben
sollte (S. 173 f). Danach sei die Wehrmacht missbraucht worden, aber
letztlich "anständig" geblieben (S. 133/134). Dass dies nicht der
Wahrheit entsprach, hatte bereits 1979 der ehemalige Luftwaffenoffizier
und bekannte Journalist Henri Nannen angesichts der Fernsehserie
Holocaust seinen "lieben Stern-Lesern" drastisch vor Augen geführt: "Wer
sich nicht Augen und Ohren zuhielt und das Gehirn abschaltete, dem blieb
nicht verborgen, dass hier das perfekteste Verbrechen seinen Weg nahm.
Wir hätten es wissen müssen, wenn wir es nur hätten wissen wollen. Wer
Soldat im Osten war, dem konnten die Judenerschießungen, die
Massengräber und beim Rückzug die ausgebuddelten und verbrannten
Leichenberge nicht verborgen bleiben" (S. 11). Dennoch oder eventuell
auch gerade deshalb war es der Russlandfeldzug, der bei dem Neuaufbau
der Bundeswehr und damit verbunden der Auswahl des Führungspersonals den
Ausschlag geben sollte. Wie Jens Scholten zeigt, wurde jedenfalls der
"Afrika-Korps-Kämpfer" Wolf Graf von Baudissin, der eine kritische und
reformorientierte demokratische "Innere Führung" in der Bundeswehr
etablieren wollte, aufgrund fehlender höherer Weihen im Russlandfeldzug
(S. 150) letztlich "wegbefördert". Speziell die Traditionsfrage erwies
sich für die Bundeswehr als heikles Problem. Nachdem der Führungsstab
des Heeres 1958 vorschlug, den geplanten 36 Divisionen der Bundeswehr
die Tradition von 36 Wehrmachtsdivisionen überzustülpen, wurde unter der
Ägide des Verteidigungsministers Franz-Josef Strauß eine externe
Expertenkommission berufen, um einen Leitfaden in Traditionsfragen zu
entwerfen (S. 165). In diesem Zusammenhang erging eine Einladung an die
vielleicht zwielichtigste Person überhaupt: Reinhard Höhn.
Höhn, promovierter und habilitierter Staatsrechtler
war "ein intelligenter Kaderpolitiker, ein frühvollendeter Intrigant und
völkischer Taktiker" [6]. Wie Tim Schanetzky in dem Kapitel über die
Unternehmer dokumentiert, zeichnete gerade Höhn eine große
Anpassungsfähigkeit aus. Nachdem er zunächst eine "mustergültige
NS-Karriere" (S. 115) verfolgt hatte, in der er u.a. die Leitung des
"Berliner Instituts für Staatsforschung" inne hatte und zugleich beim
SD-Hauptamt tätig war, musste er sich nach dem Kriegsende neu
orientieren. Er erschloss sich ein neues Aufgabenfeld, in dem er nicht
weniger "erfolgreich" seine Vorstellungen von "Menschenführung"
umsetzte. Als Leiter der "Bad Harzburger Akademie für Führungskräfte"
propagierte er ein Managementkonzept, das als "Führung im
Mitarbeiterverhältnis" und "Harzburger Modell" schnell populär wurde (S.
116). Dabei ging Höhns Managementkonzept letztlich auf die preußische
Militärtradition zurück und nahm Führungselemente der SS auf, wie etwa
die "Führerversammlung". Höhn wurde zum "Lehrer für 600.000 Manager",
wobei Schlagworte wie "Delegation und Verantwortung" und die "Innere
Kündigung" bis heute einen hohen Stellenwert genießen. Als Höhn im Jahre
2000 starb fanden sich im Nachruf in der Süddeutschen Zeitung weder eine
kritische Bemerkung zu seiner NS-Vergangenheit noch zum autoritären
Charakter des Modells (S. 116).
Gleichwohl schulte Höhn nicht nur die Wirtschaftselite
und die Bundeswehr – seine Aktivitäten erstreckten sich auch auf die
Parteien. Dabei reichte das Spektrum seiner Klienten von den Parteien
des bürgerlichen Lagers bis hin zu SPD-Funktionären und
Gewerkschaftlern. [7] Dass gerade die Parteien gefährdet waren von
"Hitlers-Elite" unterwandert zu werden, beweisen das Verbot der
"Sozialistischen Reichspartei" (SRP) durch das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) im Jahre 1952 [8] und die Zerschlagung des "Gauleiter-Kreises"
(S. 179). Insbesondere die Zerstörung des "Gauleiter-Kreises" um Dr.
Werner Naumann, der in Hitlers Testament zum Nachfolger von Goebbels'
als Reichspropagandaminister bestimmt worden war, erwies sich im Jahre
1953 als Politikum erster Güte. Zusammen mit anderen ehemals führenden
nationalsozialistischen Funktionären war es dieser Gruppe gelungen,
Nordrhein-Westfalens FDP zu infiltrieren. Als die Briten im Januar 1953
die Rädelsführer verhafteten waren diese mit ihrem Unterfangen, die FDP
zu einer "nationalen Sammlungsbewegung" aller Kräfte rechts von der
Union umzuwandeln, bereits maßgeblich fortgeschritten. [9] De facto
offenbarte diese konspirative Verschwörung ein Höchstmaß an personellen
Querverbindungen. Während Werner Naumann als Leiter der Gruppe agierte,
amtierte der FDP-Landtagsabgeordnete Ernst Achenbach als "spiritus
rector" [10]. In seinem Essener Büro wiederum war u.a. der frühere
SS-Obergruppenführer Professor Franz Alfred Six tätig. Dieser verfügte
seinerseits über gute Beziehungen zu Reinhold Gehlen und Reinhard Höhn.
So war Six zwischenzeitlich für die "Organisation Gehlen" tätig gewesen
[11] und trat in den sechziger Jahren nebenberuflich als Dozent in
Reinhard Höhns Akademie auf, wobei er bereits zu diesem Zeitpunkt
erfolgreich als Werbeleiter bei Porsche-Diesel tätig war. [12]
Vollends schließt sich der Kreis, wenn man bedenkt,
dass Six' enger Vertrauter Host Mahnke letztlich beim "Spiegel" als
leitender Redakteur arbeiten konnte (S. 269 ff). Freilich überrascht
dies in der Retrospektive nicht, denn letztlich verfügte ein Mann wie
Mahnke, der eng mit Six´ verbunden war und dieser seinerseits gute
Beziehungen zum BND und Gehlen hatte, über detailliertes
Geheimdienstwissen, was die Leserschaft des "Spiegel" offenbar besonders
zu schätzen wussten. [13]
"Karrieren im Zwielicht" ist ein beunruhigend gutes
Buch, dass keineswegs den Vergleich mit der "Macht der Fernsehbilder" zu
scheuen braucht. Überdeutlich treten die alten Seilschaften zu Tage, die
ihr Einflussgebiet auch nach der "Stunde Null" zielsicher zu wahren,
wenn nicht zu erweitern wussten. Dabei stellen die angesprochenen
Berufsgruppen nur einen kleinen Ausschnitt der "herrschenden Klasse"
dar. Weitere derartige Untersuchungen über die Parteien, die Kirchen,
die Kulturschaffenden und nicht zuletzt die "Eliten" im anderen
deutschen Staat wären daher ausgesprochen wünschenswert.
[1] Nowoskij, Walter (Hrsg.): Victor Klemperer: Ich
will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1942-1945, 7. Auflage,
Berlin 1996, S. 768.
[2] Cookridge, E.H. (alias Edward Spiro): Gehlen. Spy of the Century,
London/Sydney/Auckland/Toronto 1971, S. 135.
[3] Gehlen, Reinhard: Der Dienst. Erinnerungen 1942-1971,
Mainz/Wiesbaden 1971, S. 150.
[4] Henze, Saskia/Johann Knigge: Stets zu Diensten. Der BND zwischen
faschistischer Wurzel und neuer Weltordnung, Hamburg/Münster 1997, S.
31.
[5] Gehlen, Reinhard: Der Dienst. Erinnerungen 1942-1971,
Mainz/Wiesbaden 1971.
[6] Hachmeister, Lutz: Die Rolle des SD-Personals in der Nachkriegszeit.
Zur nationalsozialistischen Durchdringung der Bundesrepublik, in:
Mittelweg 36, Heft 2/2002, S. 17 ff (S. 19).
[7] Rüthers, Bernd: Reinhard Höhn, Carl Schmitt und andere – Geschichten
und Legenden aus der NS-Zeit, in: NJW (Neue Juristische Wochenschrift)
2000, S. 2866 ff (S. 2869).
[8] Das "SRP-Verbot" war eine der ersten Entscheidungen des BVerfG,
siehe in diesem Zusammenhang BVerfGE 2, 1 ff.
[9] Frei, Norbert: Deutsches Programm. Wie Nordrhein-Westfalens FDP
Anfangs der fünfziger Jahre bewährte Nazis zur Unterwanderung der Partei
einlud, in: DIE ZEIT 23/2002 sowie Hachmeister [FN. 6], S. 294 ff.
[10] Frei [FN. 9].
[11] Henze/Knigge [FN. 4], S. 33.
[12] Hachmeister [FN. 6], S. 338 f.
[13] Hachmeister [FN. 6], S. 316 ff. |