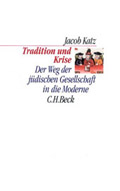
Jacob Katz:
Tradition und Krise. Der Weg der jüdischen Gesellschaft in die Moderne.
Verlag C.H. Beck,
München 2002,
39,90 Euro[Bestellen?] |
"Tradition und Krise":
Der Gott der Geschichte
Jacob Katz über den jüdischen Aufbruch in die Moderne:
"Tradition und Krise" ist erstmals auf Deutsch erschienen
Von Martin Büsser
Junge Welt, 09.10.02
Jacob Katz gilt neben Gerschom Scholem als einer der bedeutendsten jüdischen
Historiker des 20. Jahrhunderts. Er studierte in den Dreißigern bei Karl
Mannheim, emigrierte 1936 nach Palästina und arbeitete bis 1974 an der
Hebräischen Universität in Jerusalem. "Tradition und Krise", eines seiner
Hauptwerke, erschien 1961 in hebräischer Sprache und liegt nun erstmals auf
Deutsch vor. Seine Bedeutung erschließt sich erst, wenn man akzeptiert, daß
es sich nicht um ein spektakulär geschriebenes, mit kontroversen Thesen
operierendes Buch handelt, sondern um eine nüchterne, historischer
Genauigkeit verpflichtete Studie.
Katz untersucht darin die Geschichte der Juden zwischen dem 16. und 18.
Jahrhundert, was auf den ersten Blick enttäuschend anmuten mag: "Der Weg der
jüdischen Gesellschaft in die Moderne", so der Untertitel, endet bei Katz zu
genau dem historischen Moment, an dem der enorme jüdische Beitrag zum Denken
der Moderne erst einsetzte – mit Moses Mendelssohn, also mit dem Beginn der
Aufklärung. Die darauf folgende, spannende Geschichte, der Beitrag jüdischer
Intellektueller in sämtlichen wissenschaftlichen wie kulturellen Bereichen,
der unser Selbstverständnis einer modernen Gesellschaft so nachhaltig
geprägt hat, bleibt bei Katz ausgeblendet. Ihm geht es um etwas ganz
anderes, nämlich um die Untersuchung der Bedingungen, die zu einem solchen
Aufbruch haben führen können, um jene Brüche innerhalb der jüdischen
Gemeinschaft, die überhaupt erst modernistische Ideen ermöglicht haben.
"Ich habe dieses Buch nicht geschrieben", heißt es im Vorwort zur
Erstauflage, "um für eine besondere Politik der Gegenwart einzutreten." Aber
obwohl sich "Tradition und Krise" auf einen klar umrissenen, schon lange
abgeschlossenen Zeitraum beschränkt, wirkt die darin behandelte Spannung
zwischen Traditionalismus und Aufbruch bis in unsere Zeit hinein. So gelesen
ist "Tradition und Krise" ein äußerst spannendes Buch, methodologisch mit
Foucaults "Die Ordnung der Dinge" vergleichbar. Auch Foucault beschreibt die
"Erfindung des Menschen" aus dem Geist der Humanwissenschaften heraus vor
dem Hintergrund des 16. bis 18. Jahrhunderts, sorgte aber deshalb für so
viel Diskussionsstoff, weil sich hinter dieser Genealogie nichts anderes als
eine Analyse dessen verbarg, was wir geworden sind.
Dieses "Wir", das bei Foucault die gesamte westliche Gesellschaft
einschließt, beschränkt sich auch bei Katz nur vermeintlich auf die jüdische
Gemeinschaft. Ihre Gratwanderung zwischen Bewahrung der Tradition und
Modernisierung kann durchaus exemplarisch für die gesamte damalige
Gesellschaft gelesen werden. Der humanistische Kern dieser vor allem
soziologischen Geschichtsschreibung besteht darin, daß die Besonderheit
jüdischer Lebensformen zwar durchweg im Mittelpunkt steht, sich zugleich
aber auch im Allgemeinen spiegelt. Katz beschreibt, warum die jüdische
Gesellschaft lange Zeit "auf Grund ihrer sozialen wie religiösen Isolierung"
dazu neigte, "ihre Beziehungen zu anderen Klassen weitgehend unter dem
Aspekt der Nützlichkeit zu gestalten".
Die ausgeprägte Traditionspflege ist Resultat einer Ausgrenzung und
Absonderung gewesen. Ähnliches gilt für die wirtschaftliche Rolle der
politisch entrechteten Juden, die lange Zeit zu Nichtjuden rein finanzielle
Verbindungen pflegten: "Sie hatten schlicht keine andere Wahl. Ihre
persönliche Sicherheit, ihr Niederlassungsrecht und ihr Recht, Geschäfte zu
tätigen, hingen vollständig vom Herrscher ab." Katz zeigt auf, daß die
Entstehung eines "jüdischen Kapitalismus" nicht nur ein von Außen
auferlegter Zwang war – bis ins 17. Jahrhundert hinein war es Juden
verboten, sich als Handwerker zu betätigen –, sondern daß die christlichen
Herrscher den politisch entrechteten Juden die Rolle als Wirtschaftspartner
aufdrängten, "weil man nicht befürchten mußte, daß sie im Ringen zwischen
dem Herrscher und seinen Untertanen für letztere Partei ergreifen könnten."
Dies ist nur eine von vielen Stellen, anhand derer antisemitische
Stereotypen historisch entkräftet werden. Aber natürlich ging es Katz nicht
darum, mit an sich indiskutablen Vorurteilen aufzuräumen. Viel wichtiger ist
die in "Tradition und Krise" gewonnene Erkenntnis, daß sich der jüdische Weg
in die Moderne ungleich schwieriger als im christlichen Bürgertum gestaltet
hat, und daß er am Ende vielleicht deshalb nachhaltiger hat wirken können,
weil er aufgrund der Isolation als ganz und gar interner Prozeß einerseits
langsamer, andererseits reflektierter vonstatten ging. Schrittweise haben
sich die Kabbala-Bewegung, der Chassidismus und die Anhänger der Haskala –
die Hinwendung zu anderen religiösen Gruppen und die Trennung von Glauben
und Wissenschaft – aus einer internen Ablösung von Autorität und Tradition
entwickelt. Der im 18. Jahrhundert einsetzende Bruch kam schließlich einer
Revolution gleich.
Über Jahrhunderte hatte die jüdische Gemeinschaft auf Krisen, Unterdrückung
und sogar Vernichtung mit "dem traditionellen Hinweis auf göttliche Fügung"
reagiert. Mit der Haskala-Bewegung wurde plötzlich das Ideal "zum Maßstab,
an dem die Wirklichkeit kritisch gemessen wurde, und somit zum
entscheidenden Faktor der aktiven Förderung des Geschichtsprozesses." Kein
Wunder also, daß Katz sein ansonsten so nüchtern geschriebenes Buch mit
einem geradezu euphorischen Satz beendet: "An diesem wichtigen Scheidepunkt
hatten sie den Gott der Geschichte an ihrer Seite." Die Haskala bedeutete
nichts Geringeres als die totale Umkehr des Blickwinkels, von der
Vergangenheit in die Zukunft gerichtet, damit das mögliche künftige Ideal an
den gegebenen Umständen messend.
Es ist die Geburtsstunde jener großen jüdischen Tradition, die von Marx über
Benjamin bis zu Adorno verlief, der Beginn einer Epoche, in der sich noch
einmal und hoffentlich zum letzten Mal in der Geschichte all das
polarisierte, was Katz bereits für das 16. bis 18. Jahrhundert
herausgearbeitet hatte: Als Europa und vor allem Deutschland seine
finsterste Zeit erlebte, haben sich viele Juden in ihrer Verzweiflung
abermals darauf besonnen, ihre Ermordung als "göttliche Fügung" hinzunehmen,
hingerichtet von jenen Judenhassern, deren Haß sich weniger gegen die
traditionalistische als gegen die aufklärerische Tradition gerichtet hatte.
Die Weichen, die zum monströsen Massenmord und seine bis heute nachhallende
antisemitische Gesinnung geführt haben, sind sicher nicht im 18. Jahrhundert
gelegt worden. Antisemitismus hat es schon vorher gegeben.
Zu jener Zeit aber entstanden die ersten Formen einer kritischen jüdischen
Diskussions- und Debattierkultur, die bis heute dafür sorgen, daß
Antisemitismus und Intellektuellenfeindlichkeit fast immer Hand in Hand
gehen. Wenn Jacob Katz also sein Buch mit dem Ausblick beendet, daß der
"Gott der Geschichte" die Juden ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert begleitet
habe, ist dies nicht anders als ein Plädoyer für jene jüdisch intellektuelle
Tradition zu verstehen, die ihre Wurzeln sehr wohl kennt und nicht
verleugnet, sich aber auch nicht mehr darauf reduzieren und in die vor allem
von außen zugewiesenen Grenzen einsperren lassen will.
hagalil.com
16-10-02 |