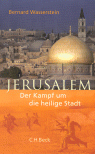
Bernhard Wasserstein, Jerusalem. Der Kampf um die heilige Stadt. 24,90
€, C.H. Beck Verlag, München 2002.[Bestellen?]
|
Am Ende seines gerechten und spannenden Buches über Jerusalem
weiß auch der in Glasgow lehrende Historiker Bernhard Wasserstein nicht mehr
weiter: "Jerusalem hat bereits so lange darauf gewartet, dass die Diplomatie mit
der Realität gleichzieht. Wie viel länger muss es wohl noch warten?" Die Frage
ist nicht rhetorisch gemeint, sondern Ausdruck einer Skepsis, die sich in den
zusammengetragenen zahlreichen Fakten nur noch deutlicher widerspiegelt.
Ohne Zorn und Eifer hat Wasserstein nicht nur die oft gewaltsame Geschichte
Jerusalems nachgezeichnet, sondern auch jeden noch so absurden Friedensvorschlag
geprüft und gewogen, wie es nur ein Freund der Menschen tun kann. Seit mehreren
hundert Jahren findet Jerusalem im Fadenkreuz dreier Weltreligionen keinen
Frieden: Christen, Juden, und Moslems reklamieren gleichermaßen die Stadt als
heilige Stätte. Eine unübersehbare Zahl säkularer Gruppen und politischer
Heißsporne hat darüber hinaus Anspruch auf Jerusalem erhoben. Damit nicht genug,
denn sämtliche europäischen Großmächte haben seit dem 19. Jahrhundert Jerusalem
für ihre Pläne im Nahen Osten zu nutzen versucht, nachdem Zweiten Weltkrieg
kamen noch die USA hinzu. Liegt ein Fluch über Jerusalem? Nein, Wasserstein kann
stets rationale Erklärungen für das allmähliche Entstehen der "Jerusalem-Frage"
vorlegen, weil er an der Möglichkeit historischer Objektivität festhält.
In einem "Prolog" über das "himmlische Jerusalem" lässt Wasserstein Vertreter
der drei Religionen Revue zu Wort kommen, um allen dreien die Gleichzeitigkeit
von Glaubensgewissheiten und mythenreichen Überhöhungen ihrer Ansprüche deutlich
vor Augen zu führen. Unter dem Strich bleibt die Einsicht, dass es keineswegs
eine Kontinuität von politischen oder Glaubensvorstellungen über Jahrhunderte
hindurch gibt, wie es die gläubige Politiker und politische Religionsführer
gerne hätten. In den darauf folgenden zehn Kapiteln
entfaltet Wasserstein, einen Dekalog historischer Tatsachen und absurder
Geschichten, die immer wieder einer Lösung der "Jerusalem-Frage" im Wege stehen.
Kaiser Wilhelm II. war bei seinem operettenhaften Ritt 1898 durch die
Jerusalemer Altstadt mit Galauniform nicht der einzige, der sich durch einmalige
Präsenz Kredit bei der Bevölkerung verschaffen wollte.
Um die Vorgänge der letzten fünfzig Jahre zu verdeutlichen bezieht Wasserstein
vermehrt Statistiken über Bevölkerungswachstum, Zahlen über die Entwicklung der
Infrastruktur und Karten über die Siedlungspolitik in Jerusalem heran, denn ab
1950 verkompliziert sich die Situation nochmals: Jerusalem wird die Hauptstadt
Israels. Und im Sechs-Tage-Krieg von 1967 hob Israel die
seit dem Sieg im Unabhängigkeitskrieg von 1949 bestehende Teilung Jerusalems in
einen israelischen Westteil und einen arabischen Ostteil wieder auf. Eine
folgenschwere Entscheidung, denn ab diesem Zeitpunkt besaßen die Moslems einen
Zielpunkt für ihre zuvor unkoordinierten Angriffe auf Israel: die Rückeroberung
Jerusalems. An den Konflikten der Folgezeit konnte, und wie Wasserstein kritisch
anzeigt: wollte, der Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek nur wenig ändern.
Wasserstein erzählt die Geschichte Jerusalems nie resigniert, auch wenn die im
"Epilog" genannten Ideen für die "irdische Stadt", etwa der vatikanische
Vorschlag einer "Internationalisierung", von den täglichen Gewaltsamkeiten
schneller überholt als bedacht werden. Doch in seine Erzählung um den "Kampf um
die Heilige Stadt" hat er einen heimlichen Optimismus integriert, die wohl nur
ein Historiker haben kann, der um die "lange Dauer" geschichtlicher Prozesse
weiß. Auch Rom habe, so Wasserstein, Italien lange entzweit, doch schließlich
ist es zur Ruhe gekommen. Religionskriege sind von besonderer Natur - man muss
der menschlichen Vernunft wieder eine Stimme geben. |