|
Gaza:
Tage und Nächte
in einem besetzten Land
Amira Hass
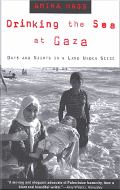
EINLEITUNG:
An einem Sommertag des Jahres 1995 fand ich endlich die
Lösung eines Rätsels, das mich seit meiner Kindheit verfolgt hatte. Unter
einem dichten Maulbeerbaum in einem Orangenhain an einem Hang, der zuerst
sanft anstieg, um dann langsam zu den Moscheen abzufallen, die sich von der
Innenstadt von Gaza bis ans Meer erstrecken, fand ich die Erklärung für
etwas, das ich viele Jahre zuvor in einem israelischen Kinderbuch gelesen
hatte. Titel und Verfasser des Buches habe ich längst vergessen, aber ich
erinnere mich an einen Jungen, der in einem kleinen Becken in einem
Orangenhain schwamm. Ich war ein Stadtkind, und so konnte ich mir zwar die
Früchte an den Zweigen vorstellen, aber ich verstand beim besten Willen
nicht, wie ein Swimmingpool in einen Orangenhain kommen sollte.
Ich fand die Lösung des Rätsels, als Freunde
in Gaza mich einluden, sie zu einer Feier im Orangenhain der Familie Raji
Souranis zu begleiten, eines Intifada-Aktivisten und Rechtsanwalts für
Menschenrechte. Als wir ankamen, war der Orangenzüchter gerade damit
beschäftigt, einen großen, rechteckigen Bewässerungstank mit Wasser
aufzufüllen. Als der Tank voll war, sprangen alle anwesenden Männer hinein.
Dabei schrien sie wie Kinder, als sie in das kalte Wasser eintauchten. (Wir
Frauen blieben auf dem Trockenen. Schließlich befanden wir uns in dem
konservativen Gaza.) Und nun verstand ich, wie das Wasserbecken in meinem
israelischen Kinderbuch in den Orangenhain kam.
Es war weder das erste noch das letzte Mal,
daß ich einen Widerhall meines Lebens in Israel in Gaza hörte, sei es im
Klang der hebräischen Sprache, die durch die Flüchtlingslager tönte, oder in
den Geschichten, die die alten Flüchtlinge von der lang verlorenen Heimat
ihrer Familien in Palästina erzählten, als seien sie erst vor einer Woche
dort gewesen, oder in den von schwarzem Humor gekennzeichneten Erzählungen
meiner Freunde von ihren Erlebnissen in israelischen Gefängnissen. Ich hatte
meine Freunde noch niemals so lachen sehen, wie sie es an diesem Nachmittag
zwischen den Orangenbäumen taten. Sie waren Wissenschaftler,
Außendienstmitarbeiter und Rechtsanwälte vom Zentrum für Recht und Gesetz in
Gaza, und sie hatten zu den ersten gehört, die mich in Gaza eingeführt und
mit seiner Bevölkerung bekannt gemacht hatten. Durch sie hatte ich eine
Vorstellung vom Leben unter der Besatzung bekommen. In ihrer Gesellschaft
hatte ich erfahren, daß das breite, entwaffnende Lächeln, das die meisten
Einwohner von Gaza dem Fremden zeigen, eine abgrundtiefe Traurigkeit
verbirgt.
Ich war als freiwillige Helferin für Workers
Hot Line {Arbeiternotruf) nach Gaza gekommen, eine israelische Organisation,
die Arbeiter aus den besetzten Gebieten bei ihren Beschwerden gegen
israelische Arbeitgeber vertrat. Damals, 1991, gehörte ich der Redaktion der
Tageszeitung Ha aretz an. Im Laufe der Zeit hatte ich begonnen, über den
Gazastreifen zu berichten, der in vieler Hinsicht Terra incognita war. Ich
knüpfte Kontakte: Die erste, die mir half, war Tamar Peleg, eine israelische
Menschenrechtsanwältin. Sie machte mich mit ihren ehemaligen Klienten
bekannt, die sie während ihrer administrativen Haft (einer besonders
verabscheuenswürdigen Einrichtung, die es gestattet, Menschen für
unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverhandlung festzuhalten) oder anderer
Gefängnisaufenthalte vertreten hatte. Der erste Name auf ihrer Liste war
Raji Sourani.
Alles weitere kam von ganz alleine: Nach der
Unterzeichnung der Grundsatzerklärung im Jahr 1993, die den Palästinensern
eine begrenzte Selbstverwaltung in Gaza und Jericho einräumte, wurde ich
Korrespondentin meiner Zeitung für den Gazastreifen und sollte über die
letzten Monate der direkten israelischen Besatzung und den Übergang der
Verwaltung auf die Autonomiebehörde berichten. Damals beschloß ich, mich in
Gaza niederzulassen. Zuerst zog ich vom Haus eines Freundes zum anderen, bis
ich mir schließlich ein Appartement in der Innenstadt von Gaza mietete. Es
erschien mir als ein normaler und logischer Schritt, nach Gaza zu ziehen.
Wie sollte ich eine Gesellschaft verstehen und über sie schreiben, wenn ich
nicht in ihrer Mitte lebte? Ich war, so erschien es mir, wie jeder andere
Journalist, der in ein fremdes Land geschickt wird, um darüber zu berichten.
Den meisten Israelis jedoch kam mein Entschluß absurd, ja wahnsinnig vor,
denn sie waren überzeugt, daß ich mein Leben aufs Spiel setzte.
Schon lange bevor ich tatsächlich dorthin
zog, war mir klargeworden, wie verzerrt die Vorstellungen der meisten
Israelis vom Gazastreifen sind - primitiv, gewalttätig und den Juden
gegenüber feindlich gesinnt. Während der ganzen Zeit, in der ich dort lebte,
habe ich immer dafür gesorgt, daß jedermann wußte, daß ich eine israelische
Jüdin bin. Diejenigen unter meinen Freunden, die Hebräisch konnten, sprachen
ohne jedes Zögern in meiner eigenen Sprache mit mir - in ihren Häusern und
Büros, auf den Straßen und Märkten, in den Flüchtlingslagern, in einem Haus
in Khan Yunis, wo die Menschen zusammengekommen waren, um ein Mädchen zu
betrauern, das während einer Unterbrechung der Ausgangssperre von
israelischen Soldaten erschossen worden war, bei einer Demonstration für die
Entlassung der politischen Häftlinge, bei der Hochzeit des Bruders eines
Bekannten. Während der Zeit, als die Nächte noch von der von Israel
verhängten Ausgangssperre und den Patrouillen der Armee beherrscht wurden,
übernachtete ich häufig in ihren Wohnungen. "Was würden deine Freunde
machen, wenn die militanten Aktivisten herausfinden würden, daß eine
jüdische Frau bei ihnen zu Gast ist?" wurde ich in Tel Aviv von einem Mann
gefragt, der einen Ruf als gut informierter Arabist hat. Die Frage kam für
mich vollkommen überraschend. Ich war noch nie auf die Idee gekommen, daß
meine Anwesenheit meine Gastgeber in Schwierigkeiten bringen könnte, und wie
ich mich später überzeugte, diese ebensowenig. Keiner meiner Freunde machte
sich diesbezüglich irgendwelche Sorgen. Sie alle hielten ihre Türen für mich
offen, sei es im Flüchtlingslager Rafah oder in al-Shatti, das sich an der
Küste vor der Stadt ausbreitet. Ihnen habe ich es zu verdanken, daß ich
gelernt habe, Gaza mit den Augen seiner Bewohner zu sehen und nicht durch
die Windschutzscheibe eines Armeejeeps oder so, wie es in den
Vernehmungsräumen des Shabak, des israelischen Geheimdienstes, gesehen
wurde.
Meine Erfahrungen in Gaza, die
Selbstverständlichkeit, mit der die Leute mich akzeptierten, die Offenheit,
mit der wir über alle Dinge miteinander redeten und sogar streiten konnten,
waren die Antwort, die ich allen Israelis gab, die mich fragten: "Wie kommt
es, daß du keine Angst hast?" und die nicht verstehen konnten, was in aller
Welt in mich gefahren war. Tatsächlich war dies jedoch nur eine halbe
Erklärung. Meistens vermied ich es, die ganze Geschichte zu erzählen.
Die andere Hälfte der Geschichte sind die
Erinnerungen meiner Eltern, von denen sie mir seit meiner Kindheit erzählt
hatten und die ich aufgesogen hatte, bis sie zu meinen eigenen wurden. Sie
waren Holocaust-Überlebende, Kommunisten, Juden aus Südosteuropa, die in
Israel lebten, und sie hatten mich mit den Sagen des Widerstands und der
Kämpfe einer verfolgten Nation aufgezogen. In der rumänischen Schule meines
Vaters in Suceava zum Beispiel war ein Drittel der Schüler jüdisch. Es
bestand eine Übereinkunft, daß diese Schüler samstags, am Sabbat, die Schule
besuchten, daß an diesen Tagen jedoch keine Klassenarbeiten oder
schriftlichen Prüfungen geschrieben werden würden. Eines Tages durchbrach
ein antisemitischer Geschichtslehrer diese Regel und setzte eine
Klassenarbeit für einen Samstag an. Als Kind hörte ich mit Begeisterung, wie
mein Vater - damals dreizehn Jahre alt und bis heute ein orthodoxer Jude,
voller Vertrauen und Sicherheit bezüglich seines Platzes in der Welt - einen
Streik unter den jüdischen Schülern organisierte und selbst die beiden
nichtreligiösen Klassenkameraden überredete mitzumachen. Der Direktor wollte
ihn von der Schule verweisen, aber alle Verbindungen wurden mobilisiert (ein
Vorgang, der in der arabischen Welt als die Anwendung von Wasta bekannt
ist), und die Strafe wurde auf einen einmonatigen Ausschluß vom Unterricht
reduziert. In ihrem Appell an einen wohlwollenden Lehrer hatten meine
Großeltern argumentiert, daß es um Religionsfreiheit und Minderheitenrechte
gehe. "Blödsinn!" hatte der Lehrer geantwortet. "Jeder weiß doch, daß der
Junge ein geborener Bolschewik ist." Mein Vater blieb sein ganzes Leben lang
ein Unruhestifter, der nicht so leicht zum Schweigen zu bringen war.
Auch meine Mutter hatte ihre Geschichten.
Auch sie war beschuldigt worden, mit den Bolschewisten zu sympathisieren,
wenn auch unter vollkommen anderen Umständen. In den Baracken von
Bergen-Belsen, wohin sie deportiert worden war, bestand die einzige Nahrung
in einer übelschmeckenden Suppe aus fauligen Rüben, und die für die
Verteilung zuständige Person hatte keinerlei Interesse daran, gleichmäßig
große Portionen auszuteilen. Meine Mutter und einige ihrer Freundinnen
übernahmen die Verteilung und sorgten dafür, daß alle die gleiche Menge
bekamen. "Was glaubst du, was dies hier ist?" brüllte der Oberaufseher sie
an. "Ein Sowjet?" Die anderen Frauen standen auch Schmiere, während meine
Mutter gegen die Vorschriften verstieß, indem sie das nationalsozialistische
Inferno in Form eines auf Papierfetzen geschriebenen Tagebuchs
dokumentierte. Außerdem unterrichtete sie heimlich die Kinder des Lagers,
ein Vergehen, mit dem sie das Leben aller Beteiligten aufs Spiel setzte.
Eine tolerante Stadt, fast idyllisch - so
sieht das Bild Sarajevos vor dem Zweiten Weltkrieg in der Erinnerung meiner
Mutter aus. Der Ruf des Muezzin, die Kirchenglocken und die in Ladino
gesungenen Sabbatpsalmen waren die Klänge ihrer Kindheit. Sie erinnert sich
auch daran, für diese Toleranz gekämpft zu haben. Muslime, Christen und
Juden lebten nebeneinander, lernten in den gleichen Klassenzimmern, gingen
zusammen an die Universität, wurden Atheisten und gingen in den
kommunistischen Untergrund. Vermutlich die einzige Ohrfeige, die meine
Mutter jemals irgend jemandem versetzte, teilte sie in dieser Zeit aus. Ein
Mitstudent, ein Muslim, hatte sich über die Juden lustig gemacht, und sie
schlug ihn. Später versöhnten sie sich wieder .
Die Vorbilder meiner Eltern waren auch die
meinen, die Szenen, die sich in ihr Gedächtnis eingegraben hatten, prägten
sich auch mir ein. Meine Mutter erzählte von ihrem Mathematiklehrer - Marcel
Schneider -, der sich einmal, als sie ihm über den Weg lief, vor ihr
verbeugte und an seinen Hut tippte. Sie war schwer mit Büchern beladen und
brachte gerade den frisch zubereiteten Hefeteig ihrer Mutter zum Bäcker, und
so reagierte sie ungeschickt und verlegen. Auch mir wurde diese würdevolle
Höflichkeit zu einer lieben Erinnerung. Jeder kannte sein Geheimnis - er war
Kommunist. Während des Krieges schloß er sich den Partisanen an, wurde von
den Nazis gefangen und gehenkt. Jahre später erschauerte ich im jüdischen
Museum in Belgrad, als ich das Flugblatt sah, das von seiner Hinrichtung
berichtete. Die Familie meines Vaters wurde in das Ghetto von Transnistria
deportiert, wo seine Eltern an Typhus und Unterernährung starben. Er konnte
niemals den Bäckerladen im Ghetto vergessen, wo Leute mit Geld und einige
Mitglieder des Judenrats sich Kuchen kauften, während hungrige Kinder
draußen standen und mit sehnsüchtigen Augen zuschauten. Wann immer ich die
frommen Legenden von der "jüdischen Einheit" höre, denke ich daran, daß
diese Einheit am Eingang von Transnistria endete.
Diese Geschichten waren das Vermächtnis
meiner Eltern - eine Geschichte des Widerstands gegen jede Ungerechtigkeit,
der offenen Meinungsäußerung und der Gegenwehr. Aber von all den
Erinnerungen, die ich mir zu eigen gemacht habe, ist mir eine ganz besonders
wichtig. An einem Sommertag des Jahres 1944 wurde meine Mutter zusammen mit
der übrigen menschlichen Fracht aus einem Viehwagen ausgeladen, der sie von
Belgrad zum Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht hatte. Als die
seltsame Prozession vorbeimarschierte, sah sie eine Gruppe deutscher Frauen,
einige zu Fuß, andere mit Fahrrädern, die stehenblieben und mit
gleichgültiger Neugier in den Gesichtern zusahen. Für mich wurden diese
Frauen zu einem abscheulichen Symbol des unbeteiligten Zusehens, und schon
in sehr jugendlichem Alter beschloß ich, daß ich niemals zu dieser Art von
Zuschauern gehören wollte.
So war mein Wunsch, in Gaza zu wohnen, nicht
auf Abenteuerlust oder Wahnsinn zurückzuführen, sondern auf die Angst, zu
einem tatenlosen Zuschauer zu werden, auf mein Bedürfnis, eine Welt, die
nach meinem besten politischen und historischen Wissen das Werk Israels ist,
bis ins letzte Detail zu verstehen. Für mich verkörpert der Gazastreifen die
ganze Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts. Er verkörpert
den zentralen Widerspruch des Staates Israel - Demokratie für die einen,
Enteignung für die anderen. Er ist unser freiliegender Nerv. Ich wollte die
Menschen kennenlernen, deren Leben durch meine Gesellschaft und meine
Geschichte für immer verändert worden war, deren Eltern und Großeltern 1948
aus ihren Dörfern vertrieben und Flüchtlinge geworden waren.
Tatsächlich fand ich sehr schnell heraus, daß
es ein besonderes Band gab, das mich mit den Flüchtlingen und den Lagern, in
denen sie lebten, verband. Ich fühlte mich zu Hause in dieser provisorischen
Dauerhaftigkeit, in der Sehnsucht, die sich an jedes Sandkorn klammert, in
dem Zorn, der in den Gassen gedeiht. Erst allmählich und nur einigen wenigen
Freunden in Gaza und Israel begann ich zu erklären, daß es mein Erbe war,
diese einmalige, autobiographische Mischung, die von meinen Eltern an mich
weitergegeben worden war, die mir den Weg in den Gazastreifen gewiesen
hatte.
ISRAEL UND PALÄSTINA:
VERZERRTE
WAHRNEHMUNGEN
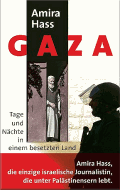
Tage und Nächte in einem besetzten Land
von Amira Hass
Beck (2003), Preis: Euro 24,90
[BESTELLEN?]
Lesungen mit Amira Hass
Amira Hass, Tochter
osteuropäischer Holocaust-Überlebender, ist Korrespondentin der israelischen
Zeitung Ha’aretz und lebt seit vier Jahren freiwillig als erste und einzige
israelische Journalistin im Gazastreifen und im Westjordanland, derzeit in
Ramallah. Für ihre ungewöhnlichen und mutigen Reportagen aus den
Palästinensergebieten wurde sie mit dem World Press Hero Award des
International Press Institute ausgezeichnet. 2002 erhielt sie den Prince
Claus Award und den Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die
Menschenrechte.
hagalil.com
10-07-03 |