|
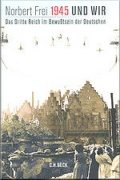
Norbert Frei:
1945 und wir
Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen
C.H. Beck Verlag 2005
Euro 19,90
Bestellen? |
1945 und wir:
Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen
Von Andrea Livnat
Norbert Frei gehört zu den führenden Zeithistoriker
in Deutschland und hat sich bereits in zahlreichen Publikationen mit
"Vergangenheitspolitik" beschäftigt. In diesem neuen Band, bei C.H.Beck
erschienen, findet sich eine Sammlung von acht bereits erschienen
Essays, die um zwei für den Sammelband neu geschriebenen Beiträge
ergänzt werden. Der Zeitpunkt der Erscheinung ist nicht nur richtig,
sondern auch wichtig, ergänzt sie doch die gegenwärtige Hochkonjunktur
zu Fragen der Erinnerungskultur um einen wissenschaftlichen Beitrag.
"Soviel Hitler war nie", konstatiert Frei, "eine Flut
von Filmen, Fernsehbildern und Erinnerungen bringt uns, den
Nachgeborenen, "1945" näher denn je". Doch in wiefern ist diese
Entwicklung der letzten Jahre tatsächlich ein Teil der aufrichtigen und
selbstkritischen Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit? Wir
stehen an einem Epochenende, das Frei als Übergang von der
Zeitgenossenschaft zur "Arena der Erinnerungen"" bezeichnet. Das
vergangene Jahrzehnt habe sich als "Dekade der Zeitzeugen" erwiesen, in
den Medien rückten immer mehr "die Menschen in den Vordergrund - ihr
Leid wie ihre Verbrechen, ihre Handlungsspielräume wie deren Grenzen".
Dabei habe es auch einen Prespektivenwechsel gegen, von
den Opfern der Deutschen zu den Deutschen als Opfer. Die Ausführungen
über den "Bombenkrieg" von Jörg Friedrich hält Frei noch immer für eine
Ausnahme, doch könne man immer mehr und öfter "erstaunlich unpolitische
Töne einer privatistischen Geschichtsbetrachtung (vernehmen), in der
sich die Unterschiede zwischen Tätern, Opfern und Mitläufern
verwischen." Die Rede von Martin Walser in der Paulskirche sieht Frei
dabei als das spektakulärste Beispiel für sich wandelnde Positionen,
seitdem sei die Suche nach einer Definition des Verhältnisses zur
deutschen Vergangenheit aus neuem Blickwinkel eröffnet.
In aller Deutlichkeit weist Norbert Frei auf eine
Situation hin, die meines Erachtens besondere Aufmerksamkeit erfordert.
Die Begegnung mit der Kriegsgeneration in jenem Epochenübergang führt zu
einem Prozess der Diffusion, der auch die Wahrnehmung auf die Generation
des Krieges beeinflusst und zu einem Transfer von Empathie führt. Die
Deutschen der "ersten Generation", so Frei, rücken dorthin zurück, wo
sie sich selbst 1945 gesehen haben, als Opfer des Nationalsozialismus.
Die Folge daraus ist für die Formen der Erinnerung in der Zukunft von
besonderer Brisanz: "Damit stehen, weil die Täter fast ausnahmslos
gestorben sind, den wenigen noch lebenden Opfern des Holocausts und
anderer nationalsozialistischer Verbrechen sowie deren Kindern und
Kindeskindern inzwischen immer mehr Deutsche gegenüber, die sich
ihrerseits als Opfer begreifen."
In verschiedenen Kapiteln behandelt Norbert Frei die
Nachgeschichte des Nationalsozialismus und untersucht dabei unter
anderem das Epochenjahr 1933, den Mythos Stalingrad, Justiz und
Zeitgeschichte nach 1945 und Geschichte, Geheimnis und Gedächtnis von
Auschwitz. Die Untersuchung der Nachgeschichte jener "Erinnerungsorte"
der deutschen Geschichte legt den Blick frei auf kollektive Mythen, "die
Europa auch sechs Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch
beschweren." In der Zukunft werden neue Anstrengungen gefragt sein, wenn
es um die Vergegenwärtigung der nationalsozialistischen Vergangenheit
geht, bilanziert Norbert Frei. Dazu sei nicht nur die Bereitschaft zur
Erinnerung nötig, sondern auch Wissen und ein aufgeklärtes
Geschichtsbewusstsein.
Norbert Freis Band leistet sicherlich einen
wertvollen Beitrag zur Forschung der Zeitgeschichte und Erinnerung und
ist dabei auch für das breite Publikum mit großem Gewinn zu lesen.
Gerade in dieser Zeit der "Neujustierung unserer
Geschichtsverhältnisses" ist eine eindringliche Stimme, wie die von
Norbert Frei, besonders von Nöten.
hagalil.com
08-05-05 |